Steiner, Rudolf,
Mein Lebensgang. 19. - 22. Tausend. Dornach: Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1949. 374 Seiten mit Register. Leinen. 223 x 148 mm. 648 g
* Mit vier Bildnissen, zwei Handschriftproben und dem Nachruf einiger Schüler herausgegeben von Marie Steiner. - Einband schwach lichtrandig und stockfleckig
Bestell-Nr.160747
Steiner |
Anthroposophie |
Anthroposophy |
Autobiographie |
Memoiren
Inhalts-Ubersicht
1861—1871
Kindheitseindrücke und erster Unterricht. Dorfschule Kapitel
und Selbsterziehung.
Kraljevec. Mödling. Pottschach. Neudörfl. I
1871—1879
Jugendliches Erkenntnisstreben, besonders auf den
Wegen der Mathematik und Geometrie. Realschule.
Die Lehrer. Betätigung durch Privatunterricht.
Wiener-Neustadt. JI
1879 —1882
Besuch der technischen Hochschule in Wien. Die Gym¬
nasialbildung wird daneben erworben durch die Not¬
wendigkeit, andere zu unterrichten. Philosophisches
Studium und ernstes Ringen mit Erkenntnieproblemen. Schröers literarische Vorlesungen und RedeÜbungen. Der junge Steiner hält Vorträge über ,,Laokoon“ und „Inwiefern ist der Mensch ein freies
Wesen?“. In der Universität werden die Vorlesungen
von Robert Zimmermann und Franz Brentano belegt,
ln der Hofbibliothek und der Bibliothek der tech¬
nischen Hochschule die Werke der Philosophen stu¬
dierte. Erste Bekanntschaft mit „Faust“. Kampf mit
den Wissens- und Weltauffassungsrätseln. Das RaumProblem und seine Lösung: die sich im Unendlichen
verlierende Linie kehrt im Kreise zurück. Enttäu¬
schungen des Erkenntnisstrebens am Zeitenrätsel.
Geistige Schauungen. Bekanntschaft mit dem Heil¬
kräutler aus den Alpen. Anfänge der Herausarbei¬
tung einer Erkenntnistheorie. Studium von Hegel, da-
neben von Herbart, V = Vischer, Robert Mayer.
Bekanntschaft mit Reitlinger. Studium der mechani¬
schen Wärmetheorie und der Wcllenlehre für Lichtund Farberscheinungen. Schwere Seelenkämpfe. In¬
nere Hilfe durch Mathematik und synthetische Geo¬
metrie. In Schillers Briefen über „Ästhetische Er¬
ziehung des Menschen“ wird von dem Bewußtseins¬
zustand gesprochen, in dem die Schönheit der Welt
erlebt wird, kann es einen solchen geben für die
Wahrheit? Im Erleben der Gedanken als
geistige Schauungen, verbunden mit der Helligkeit
des Bewußtseins, gelangt man zu einer geistigen Wirk¬
lichkeit, die man dann auch im Innern der Natur
wiederfindet.
Wien. Inzersdorf.
1882—1884
;Die Welt des Tons wird erlebt als Offenbarung einer
‘wesentlichen Seite der Wirklichkeit. Das Erlebnis des
Musikalischen in der Tonformung. Wagnertum;
Freundschaftsbündnisse. Das Durchschauen der Wirk¬
lichkeit und Geistigkeit des Ich. Rudolf Steiner wird
Vorsitjender der „Lesehalle“. Besuch der Parlamentssitjungen; markante Persönlichkeiten daselbst.
Wien.
Die Nationalitätenfrage in Österreich. Die deutschen
Kulturzentren in den slawisch-magyarischen Ländern.
Schröers Wirken für das Deutschtum. Die alten Weihnachtsspiele. Schröers Idealismus; seine Goethe-Ver-'
ehrung. Rudolf Steiners objektiver Idealismus. Aus¬
einandersetzung mit den herrschenden Theorien über
Schall und Licht. Experimente in physischer Optik.
Erweitertes Studium der zeitgemäßen Anatomie und
Physiologie. Erlösung durch Goethes geistgemäße
Naturanschauung. Die Anschauung sinnlich-übersinn- |
lieber Formen als Ergebnis der Erfahrung und der >
seelischen Dreigliederung des Menschen. Mannigfal- '
tige pädagogische Arbeit.
Wien.
Kapitel
III
IV
V
427
188 i—1886 Kapitel
Antritt einer Erzieherstelle und hingebungsvolles pä¬
dagogisches Wirken. In die Interessensphäre tritt
Eduard von Hartmanns Philosophie. Kürschners An¬
gebot, die Einleitung zur Herausgabe von Goethes
naturwissenschaftlichen Schriften zu schreiben. Sie er¬
scheint 1886. Goethe, der Galilei der Organik, und
Goethes Metamorphosenlehre. Goethes Art der Na¬
turbetrachtung führt zu Geisteswissenschaft. Dies zu
begründen bedurfte es einer neuen Erkenntnistheorie.
1886 erscheint die Schrift: Erkenntnistheorie der
Goethe'schen Weltanschauung.
Wion und Attprsec. VI
1886—1889
Erlebnisse mit Freunden. Der geheimnisvolle I nbekannte-Bekannte. Marie Eugenie delle Grazie und
Laurenz Müllner; der Verkehr in ihrem Kreis. An¬
dere markante Erscheinungen aus Wiener Gelehrtenund Künstlerkreisen. Ablehnung von Sinetts Buch
„Esoterischer Buddhismus“.
Wien. VII
1886 1896
Scharfe geistige Konzentration im inneren Seelen¬
leben und ausgebreiteter geselliger Verkehr. Robert
Hamerling und sein satirisches Epos Homuneulus.
Nachsinnen über die Irrtümer der bloß idealistischen
Philosophie in der Ästhetik. Das Wesenhafte der
Idee fehlt der realistischen Ästhetik. Dem sinnlichen
Erscheinen der Idee in der Kunst stellt Rudolf Steiner
entgegen die Darstellung des Sinnlichen in der Form
des Geistes. Aus dem Sinnen über wahre Erkenntnis,
über die Erscheinung des Geistigen in der Kunst und
dem sittlichen Wollen im Menschen gewinnt Rudolf
Steiner die Anschauung der moralischen Intuition, die
den Menschen zur freien sittlichen Tat führt und
ihn den Geist erleben läßt. Erste Konzeption der
„Philosophie der Freiheit“. Gesellige Kreise von
Künstlern und Schriftstellern. Erste redaktionelle
428
Tätigkeit in der „Deutschen Wochenschrift“. Bezie- Kapitel
hungen zu Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Victor Adler. Studium von sozial-ökonomischen
Schriften. Die Tragik der sozialen Frage.
Wien. VIII
1888—1889
Einladung zur Mitarbeiterschaft an der Weimarer
Goetheausgabe auf Grund der Veröffentlichungen
Rudolf Steiners zur Goethcliteratur. Erste Reise nach
Deutschland. Studium der Goethe-Papiere im Archiv.
Ausbau der Erkenntnisgrundlagen, die Goethe gelegt
hat, um von seiner Anschauungsart denkend hinüber¬
zuleiten zu einer solchen, die geistige Erfah¬
rung in sich aufnehmen kann. Produktives Bewußt¬
sein. Persönlichkeiten des Archivs. Herman Grimm.
Gustav von Loeper, Wilhelm Scherer. Kurzer Aufent¬
halt in Berlin und persönliche Bekanntschaft mit
Eduard von Hartmann in Berlin. Besuch in München
und Besichtigung seiner Kunstschätje. Weitere päda¬
gogische Tätigkeit in Wien. Literarisch-geistige Gesellschaftszcntren hei Marie Lang, Rosa Mayreder.
Ein gewisser Abschluß des Seelenstrebens der drei
ersten Jahrzehnte lebt in der ..Philosophie der Frei¬
heit“.
Weimar. Berlin. München. Wien. IX
1889—1890
Übersiedlung nach Weimar zur siebenjährigen Arbeit
am Goethe-Schiller-Archiv. In Schriften und Aufsätjen
wird das sinnlichkeitsfreie Denken als dasjenige hin¬
gestellt, mit dem die Seele in dem geistigen Wesen
der Welt darinnen steht. Widerlegung der Anschau¬
ung von Erkenntnisgrenzen. „Das Gewahrwerden der
Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion
des Menschen.“ Auseinandersetzung mit den Erkennt¬
nistheoretikern der damaligen Zeit und Anknüpfung
an Goethes geistgemäße Naturanschauung, um diese
zur unmittelbaren Geistanschauung fortzuführen. Wei¬
tere Ausgestaltungen der „Philosophie der Freiheit“.
Weimar. X
429
Innere Auseinandersetzung mit der Art des Erlebens
der Mystiker. Sie suchen Befreiung von der Kalte
der Ideen in der subjektiven Seelenwärme und kön¬
nen den Geist in den Ideen nicht schauen; die Ver¬
stärkung des eigenen Innenlebens im Fühlen droht,
die wahre Gestalt des objektiven Geistigen auszu¬
löschen. Schwierigkeiten der Ausdrucksform. Die
Ideengestalten der „Philosophie der Freiheit“ lehnen
sich an die naturwissenschaftlichen Begriffe an.
Weimar.
Die Darstellungen von GoetHes naturwissensdhaftliehen Ideen für die Einleitungen zu „Kürschners
Deutscher Nationalliteratur“ werden erst abgeschlos¬
sen nach Überwindung der geschilderten Schwierig¬
keit in der mystischen und naturwissenschaftlichen
Ausdrucksart. Eroberung einer Methode, um über
Goethe in Goethes Art zu sprechen. Das Schicksals¬
gemäße der Goethe-Aufgabe verlangt, daß die eigene
schnellere geistige Entwickelung zurückgestellt werde.
Harmonisierung beider Strömungen im eigenen Be¬
wußtsein. Goethes „Märchen von der grünen Schlange
und der schönen Lilie“ wird zum wichtigen Medita¬
tionsstoff.
1890
Tragische Ideale der besten Wiener. — Niegsches
„Jenseits von gut und böse“. — Niegsche — einer
der tragischsten Menschen der damaligen Gegenwart.
— Der Aufsag über Hamerlings „Homunculus“ führt
zu privaten Schwierigkeiten wegen des erwachenden
Antisemitismus. — Ignag Brüll, Dr. Breuer, Dr.
Freud. — Berufung in das Goethe-Schiller-Archiv
als freier Mitarbeiter: „Den ständigen Arbeitern hat
sich seit dem Herbst 1890 Budolf Steiner aus Wien
zugesellt. Ihm ist (mit Ausnahme der osteologischen
Partie) das gesamte Gebiet der „Morphologie“ zu¬
geteilt . . .“
1890
Weimar und die Arbeit im Goethe-Schiller-Archiv.
Herxnan Grimm. Vor dem Eintritt in We i ina r als
Mitarbeiter im Goethe- und Schiller-Archiv wird das
Kapitel
XI
XII
XIII
430
Doktorexamen Kapitel in Rostock bestanden: Dissertation
über den Versuch einer „Verständigung des mensch¬
lichen Bewußtseins mit sich selbst“. Die Stimmung
der „Sieben Bücher Platonismus“ von Heinrich v.
Stein wirkt noch in Weimar nach. -— Dr. Steiners
Aufsaß im 12. Band des Goethe-Jahrbuchs anfangs
1891: „Über den Gewinn unserer Anschauungen von
Goethes naturwissenschaftlichen Arbeiten durch die
Publikationen des Goethe-Archivs.“ Bernhard Suphan,
Erich Schmidt, von Loeper, Herman Grimm. Wilhelm
Scherer, Julius Wahle. Grimms „Idee einer Geschichte
der deutschen Phantasie“, sein Aufsaß über Griechen¬
tum, Römertum, Mittelalter. Großherzog Carl Alexan¬
der. Die Großherzogin Sophie, Besitzerin des Archivs.
Erbgroßherzog Carl August. Erbgroßherzogin Pauline
und ihr warmes Interesse am Archiv. Der Ober¬
bibliothekar der Weimarischen Bibliothek, Reinhold
Köhler.
Rostock. Weimar.
1890—1894
Zwei Vorträge Dr. Steiners; in Weimar: „Die Phan¬
tasie als Kulturschöpferin“; im Wiener wissenschaft¬
lichen Club: „Von der Möglichkeit einer monistischen
Weltauffassung“. Studien über Goethes Verhältnis
zur Naturanschauung und über den Monismus.
Haeckel. Persönliche Bekanntschaft mit Haeckel;
sein 60. Geburtstag. Treitschke. Ludwig Laistner. Der
Freundeskreis in Weimar.
Weimar.
1890-1894
Gabriele Reuter. Schilderung verschiedener Kreise
von Journalisten und Schriftstellern. Lebhafter Ver¬
kehr und starker Anteil an der Außenwelt; eigene
Einsamkeit durch das Erleben der geistigen Wirk¬
lichkeit. Die „Goethe-Versammlungen“. Otto Harnacks: „Goethe in der Epoche seiner Vollendung“. Die
verschiedenen intellektuellen Standpunkte. Das Faszi¬
nierende des Intellektualismus.
Weimar.
XIV
XV
XVI
431
Kapitel
1894—1896
Tlie Gesellschaft für ethische Kultur“. Rudulf Stei¬
ners A^fsafc in der „Zukunft“: eine weltansdiauungslose Ethik muß bekämpft werd71’ »i,.
streben —, findet kein Verständnis. Es «r8^le1“* d,e
u- Freiheit“ In ihr wird dargelegt,
U'6V- '“"w“. h« ‘a'« tÄTdteJeu ibr.»
leständ sltt d£ Sinnenwelt in Wirklichkeit geisti¬
ger Wesenheit; der Mensch als seelisches W*8eVrt*h
und lebt in einem Geistigen und erlebt ;in ihr
S?e sittüchen Impulse innerhalb seiner persönlichen
Individualität. — Es ist die Darstellung einer Anhroposophie, die auf die Natur hm und das !5t«h« “
Menschen in der Natur mit seiner sittlichen Wesen
heU orientiert ist. Die Ideengestaltung ist gegeben
durch das Erleben der naturwissenschaftlichen Dseinsrätsel. — Der weitere Weg ist nun el” p
für die Ideengestaltung der geistigen Welt selbst.
Das Studium von Friedrich Niefcsche verdichtett sich
im Buche „Nietjsche als Kämpfer gegen seine Zeit ,
189=; Das Erlebnis von Niefcsches Persönlichkeit.
Eugen Dührings philosophisches Werk un ^
Ewige Wiederkunft des Gleichen“. FrifcKoegel, der
llJäLgeber ... Ni.g.d,e. Werke» Der Ko»«.k>
"i, Frlu Foerster-Nieksdie. Das P “'
Niehsche. Goethe fand den Geist in der INalurwirk
lichkeit; Nietjsdie verlor den Geist-Mythos in e
Naturtraum, in dem er lebte.
Weimar.
Weimar ‘^.d"
Zergl ederung unserer Erkenntn.statigkeit fuhrt. • -
l:£r OberLagung. d.B di. Frage» d.«
Natur zu stellen haben, eine Folge des eigentum
Hdien Verhältnisses sind, in dem * 0«o Fröhhen“ usw. Weimars Künstlerkreis. Maler Otto Fro
lieh. Aufführungen W.gnersAer Miisikdr.mei.. Inten¬
dant von Bronsart. Heinndt Zeller. Agnes Maven
XVII
XVIII
432
hagen, Bernhard Stavenhagen. Der Geist Goethes in
Weimar spürbar bis zum Ende des Jahrhunderts. Der
alte Großherzog.
Eduard von der Hellen wird Archiv-Mitarbeiter.
Seine Interessen bringen das politische Lehen heran.
Zahlreiche Versammlungen. Die Wiederbelebung der
„Deutschen Wochenschrift“ wird von Rudolf Steiner
abgelehnt. Der Weimarer Freundeskreis. Die^ Wei¬
marer Seelengestalt, ein Erlebnis gleich dem früheren
in Wien. Der Philologe Fresenius und seine Ent¬
deckung. Franz Ferdinand Heitmüller bringt etwas
Künstlerisches in den Kreis der Archiv-Mitarbeiter.
Intime Freundschaft mit dem Maler Joseph Rolletscheck. Max Christlieh bringt Verständnis entgegen
für die lebendige Wirklichkeit der Ideenwelt.
Rege Tätigkeit als Mitarbeiter eines Weimarischen
Blattes über das zeitgenössische Geistesleben; An¬
regungen, die später im „Magazin für Literatur
fruchtbar wurden. Die Freundschaft mit dem Schau¬
spieler Neuffer. Dr. Steiner entdeckt eine „Hegel¬
büste“ von Wichmann aus dem Jahre 1826 und er¬
hält sie. Der dänische Dichter Rudolf Schmidt. Con¬
rad Ansorge, der Liszt-Schüler, und v. Crompton, der
Nietjsche-Bekenner. Starkes künstlerisches Empfinden
lebt in diesem Kreise, der strenge Kritik an Weimar
übt. — Es entsteh* nun der letjte Band der ^Ein¬
leitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schrif¬
ten und das Buch „Goethes Weltanschauung“, mit
dem die Weimarer Tätigkeit abgeschlossen wird.
Weimar.
1897
Die letjte Weimarer Zeit. Tiefgehender seelischer
Umschwung im 36. Lebensjahr. Das wahrnehmende
Erfassen der Sinneswelt wird besonders genau und
eindringlich. Durch ein vollkommen objektives Sichgegenüberstellen der Sinneswelt steigert sich wie¬
derum das Beobachtungsvermögen in der geistigen
Welt. Einstellung der Beobachtungsgabe auf das
Kapitel
XIX
XX
XXI
28
433
Objektive Kapitel im Menschen. Die Seele des Menschen gibt
den Schauplafj her, auf dem die Welt ihr Dasein und
Werden zum Teil erst erlebt. Die Lösung des Wel¬
tenrätsels liegt im Menschen selbst. Erkenntnis ge¬
hört zum Sein und Werden des Weltinhalts. —
Schwere innere Erfahrungen. Das Meditieren wird
seelische Lebensnotwendigkeit. Das Willensmäßig«'
tritt an die Stelle des Ideellen. Darwin. Haeckel
Lyell.
Weimar.
Der „ethische Individualismus“ in Rudolf Steiners
Weltanschauung. Der Mensch selbst wird das Wort
für die von ihm wahrgenommene Außenwelt. Der
materialistisch gesinnte Naturforscher macht die
Welt zur Illusion. Der Artikel „Die Welt der Illu¬
sion“ in „Welt- und Lebensanschauungen im neun¬
zehnten Jahrhundert“, in der alle Ideen verarbeitet
werden, erscheint vier Jahre später. Vollkommener
Gegensag zu den Ansichten des Zeitalters. Wie kann
der Weg gefunden werden, um das innerlich als wahr
Geschaute in Ausdrucksformen zu bringen, die dem
Zeitalter verständlich sind?
Weimar. Berlin.
1899
Die Frage wird Erlebnis: Muß man verstummen? —
Die Wege des Schicksals nehmen nun einen andern
Sinn an. Die von der Außenwelt kommenden Rich¬
tungen stehen nicht mehr in Einklang mit dem
inneren Seelenstreben. Nicht verstummen, sondern
so viel sagen, als möglich ist, wird inneres Gebot. -—
Dic Unmöglichkeit, eine eigene Zeitschrift zu grün¬
den, um geistige Impulse in die Öffentlichkeit zu
tragen, führt zur Übernahme der Herausgeberschaft
des „Magazin für Literatur“. Damit war die Not¬
wendigkeit gegeben, eine Tätigkeit zu entfalten, um
den Abonnentenkreis zu erhöhen; sie ergab sich in
der „Freien literarischen Gesellschaft“. Deren geistige
Bedürfnisse mußten aber beachtet werden. Otto Erich
Hartleben wird Mit-Herausgeber. Eigenartige Persön¬
lichkeiten des literarischen Kreises. O. J. Bierbaum.
XXII
XXIII
434
Frank Wedekind. Paul Scheerbarth. Außer Harlan
sind es mehr Literaten als Menschen. Mangelndes Ver¬
ständnis für ein geistiges Wirken.
Berlin.
Mit dem Magazinkreis steht im Zusammenhang die
Dramatische Gesellschaft“. Rudolf Steiner wird in
den Vorstand gewählt. Interessante Erfahrungen auf
diesem Gebiet (Maurice Maeterlincks „Der Unge¬
betene“ [l’intruse]). Aber das lebendige Zusammen¬
wirken der Zeitschrift mit der lebenden Kunst wird
erschwert. Es konnten die Absichten nicht durch¬
geführt werden. Hinweis auf Aufsätze aus dem
Jahre 1897, zum Beispiel über: „Ein Wiener Dichter
(Peter Altenberg)“, über: Rudolf Heidenhain; 12. Fe¬
bruar 1898 im „Magazin“.
Berlin.
Gegen die Jenseitslehre der christlichen Bekenntnisse
wendet sich Rudolf Steiners ethischer Individualis¬
mus. Dadurch entsteht eine starke Prüfung, ver¬
bunden mit inneren Stürmen. Sie wird überwunden
durch die geistige Anschauung der Entwickelung des
Christentums. Sie führt zu den Erkenntnissen, die
später niedergelegt sind in dem Buche „Das Chri¬
stentum als mystische Tatsache“. Der wahre Inhalt
des Christentums entfaltet sich als innere ErkenntnisErscheinung.
Berlin.
Die Jahrhundertwende des neuzeitlichen Geistes¬
lebens muß der Menschheit ein neues geistiges Licht
bringen. Die im XIX. Jahrhundert lebenden Impulse,
die auf Hegel und Stirner zurückführen, haben keine
Kraft, die Wirklichkeit zu beeinflussen. Freundschaft
mit dem Stirner-Herausgeber Mackay. Als geistige
Prüfung tritt der Versuch heran, den rein inner¬
lichen ethischen Individualismus zu etwas Äußer¬
lichem zu machen. Er steht nach der Prüfung wieder
an seinem richtigen Ort. Sorgen um die Existenz¬
möglichkeit des Magazins.
Berlin.
Kapitel
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
435
Übertragung Kapitel eines Lehramts an der Arbeiterbildungs¬
schule. Unterricht, Redeübungen und Geschichts¬
unterricht. Anfang: 1899 — Ende: 1904 durch den
Widerstand der Vertreter des geschichtlichen Materia¬
lismus. Es wurden die ideell geistigen Impulse der
Geschichte sachgemäß besprochen. Das wird ver¬
boten. - Trennung der bürgerlichen und Arbeiter¬
klassen. Den weltbewegenden Fragen des Prole¬
tariats fehlt jede geistige Sphäre.
Einiges über Vortragskunst und Sprachgestaltung.
Die „Dramaturgischen Blätter“ März 1898. Die
Freundschaft mit Ludwig Jacobowski. Der literari¬
sche Kreis „Die Kommenden“. Paul Asmus. Martha
Asmus und Wolfgang Kirchbach. Bruno Wille und
Wilhelm Bölsche, die Friedrichshagener. Die Freie
Hochschule. Der Giordano-Bruno-ßund und seine
monistische Weltanschauung. Aufsteigende Gegensätje.
Ein dort gehaltener Vortrag wird Ausgangspunkt
einer anthroposophischen Tätigkeit. Sie soll den Er¬
kenntnisbedingungen der Gegenwart entsprechen.
Friedrich Eckstein, ein Kenner alter Geist-Erkenntnis,
vertritt den Standpunkt der Geheimhaltung esoteri¬
scher Weisheit. H. P. Blavatsky. Die Anschauung der
Geheimhaltung esoterischen Wissens ist ein Anachro¬
nismus.
Goethes 150. Geburtstag. Der Wille, das Esoterische
zur öffentlichen Darstellung zu bringen, bewirkt den
zum 28. August 1899 im „Magazin für Literatur“
erschienenen Aufsatj „Goethes geheime Offenbarung“.
Das „Magazin“ erweist sich unzulänglich fiir reales
geistiges Wirken und geht Ende 1900 in andere
Hände über. Aufforderung zu einem Vortrag über
Goethes geheime Offenbarung im Brockdorffschen
Kreis. Daran anschließend Vorträge über die Mystik
des Mittelalters. Im Kreise der „Kommenden“ Vor¬
träge „Von Buddha zu Christus“. Die Theosophische
Gesellschaft. Vorträge über „das Christentum als
mystische Tatsache“ in der Theosophischen Gesell¬
schaft. Die Aufforderung, dort zu wirken. Begegnung
mit Marie von Sivers. Als Bücher erscheinen:
„Welt- und Lebensanschauungen im neunzehnten
Jahrhundert“ und „Haeckel und seine Gegner“.
Berliner Literatenkreise. An Hans Kraemers Sam¬
melwerk über die Kulturerrungenschaften des neunXXVIII
XXIX
XXX
436
zehnten Jahrhunderts ist Rudolf Steiner beteiligt
durch Schilderung des literarischen Lebens. An
Arthur Dix „Egoismus“ durch den Aufsa^: „Der
Egoismus in der Philosophie“; er müßte eigentlich
..Individualismus in der Philosophie“ heißen. — 1902
übernehmen Dr. Steiner und Marie von Sivers die
Führung der deutschen Sektion der The.osophischen
Gesellschaft. — Besuche in London und Paris. All¬
mählich sich einstellende Dogmatik in der Theosophischen Gesellschaft. Verfallserscheinungen seit 1906;
gewisse Betätigungen erinnern an Auswüchse des
Spiritismus. Weiterer Unfug: die Begründung des
Sterns des Ostens. Annie Besant effektuiert den Aus¬
schluß der Deutschen Sektion 1913. Gründung einer
selbständigen Anthroposophischen Gesellschaft. Neben
der Vertiefung der Anthroposophie wird besonderer
Wert auf die Pflege der Kunst gelegt.
Das öffentliche Wirken für Anthroposophie. Be¬
gründung der Zeitschrift „Lucifer-Gnosis“. HiibbeSchleidens Wirken; sein Atomismus. Goethes geist¬
gemäße Naturbetrachtung wird immer wieder dem
entgegengestellt; sein Urphänomen. — Anfang der
Verlagstätigkeit.
Die Vortragstätigkeit gewinnt immer mehr an
Umfang.
Der Wert des Arbeitens im Künstlerischen neben
dem Streben nach realer Geist-Erkenntnis in der
anthroposophischen Bewegung. Die Kunst der Wort¬
gestaltung.
Das Wirken für Anthroposophie durch Bücher.
Privatdrucke, Zyklen.
Weiteres über anthroposophische Tätigkeit. Die
Reisen. Der theosophische Kongreß in Paris. 1906.
Der Pariser Vortragszyklus. Edouard Schure.
Kapitel
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
und
XXXVII
437
Einiges über die Geschichte der Anthroposophischen
Bewegung. Das Wirken in Berlin und München.
Gräfin Pauline von Kalckreuth. Sophie Stinde. Frau
von Schewitsch. Der Münchener Kongreß von 1907.
Aufführung des Schureschen Mysteriums von Eleusis.
Durch die anthroposophische Strömung wird der
theosophischen Bewegung eine neue Haltung gegeben;
dieses aber wurde nicht geduldet.
Kapitel
XXXVIII
438



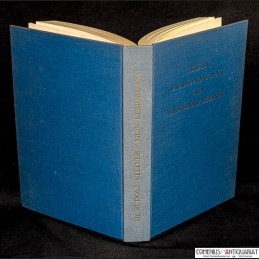
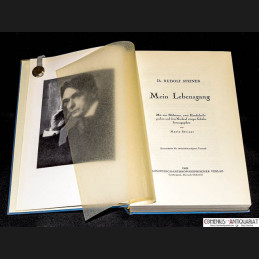
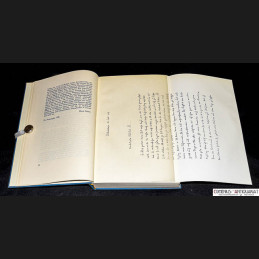
 Privacy
Privacy
 Shipping Costs
Shipping Costs
 Google Mail
Google Mail
