Schlesinger, Arthur M.,
Das erschütterte Vertrauen. Bern, München, Wien : Scherz, 1969. 256 Seiten. Leinen mit Schutzumschlag. 209 x 135 mm. 400 g
* Originaltitel: The crisis of confidence; aus dem Amerikanischen von Wolfgang J. u. Christa Helbich.
Bestell-Nr.161280
Schlesinger |
Politik |
Nordamerika
Wohin treiben die USA - dies fragen sich heute sowohl Amerikaner wie Nichtamerikaner.
Amerika befindet sich in einer zweifachen Krise: einer inneren, die Institutionen und anerkannte Werte der Nation erschüttert, und einer äußeren, die das Verhältnis der Vereinigten Staaten zur übrigen Welt betrifft.
Bis vor kurzem noch lebten die Amerikaner in der Überzeugung, dank ihrer physischen und moralischen Überlegenheit gegen jede ernste Bedrohung gefeit zu sein. Inzwischen haben Uneinigkeit, Fanatismus und Gewalttätigkeit die USA in immer größere Bedrängnis gebracht und das Vertrauen in die Zukunft immer mehr erschüttert. Arthur M. Schlesinger, als «Insider» ein hervorragender Kenner der amerikanischen Politik, hat gleichzeitig als Historiker die notwendige Distanz, um die Ursachen der Vertrauenskrise, die die Gültigkeit der überkommenen Wertmaßstäbe im eigenen Land und die Rolle Amerikas als Verteidiger der freien Welt in Frage stellt, kritisch zu untersuchen.
Auf innenpolitischem Gebiet geht er der Rolle der Gewalt in der amerikanischen Geschichte bis in die jüngste Gegenwart nach und erinnert daran, daß Ideale und Vernunft in der Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung waren.
Auf außenpolitischem Gebiet analysiert er am Beispiel Vietnam den Zusammenbruch der amerikanischen Illusionen. Er zeigt die Wirkung von Gewalttätigkeit und Unvernunft auf die Jugend und wägt Mittel und Möglichkeiten ab, die es den demokratischen Institutionen erlauben, den Herausforderungen der Unvernunft zu begegnen.
Schlesinger legt mit diesem Buch die bedeutendste Analyse der amerikanischen Gegenwartssituation vor. Er zeigt, daß die USA noch immer ein Experiment sind, und er warnt gleichzeitig vor der «Gefahr der Resignation». «Jede Gesellschaft muß», so sagt er, «auf die Dauer auf Freiheit und Vernunft beruhen. Wenn wir sie preisgeben, geben wir alles preis.»
Inhalt
Vorwort 11
I Gewalt — Teil des American way of life 17
1 Eine kranke Gesellschaft? 19
2 Die amerikanische Tradition der Gewalttätigkeit 24
3 Der amerikanische Traum vom Schießen 31
4 Fernsehen und Gewalttätigkeit 36
5 An der Demokratie verzweifeln? 42
6 Existentielle Politik 45
7 Die Verantwortung anerkennen 54
II Der Intellektuelle und die amerikanische Gesellschaft 59
1 Der Aufstieg des modernen Intellektuellen 60
2 Intellektuelle und die Amerikanische Revolution 64
3 Der Rückzug aus der Politik im 19. Jahrhundert 70
4 Die Rückkehr der Intellektuellen 76
5 Die neue Feindseligkeit gegen die Politik 85
6 Intellektuelle und Macht in der Demokratie 93
III Der Ursprung des Kalten Krieges 98
1 Das Aufkommen des Revisionismus 99
2 Der Universalismus 103
3 Einflußsphären 107
4 Die amerikanische Analyse 116
5 Verwirrung auf dem Gipfel 121
6 Die Asymmetrie des Totalitarismus 129
7 Die Konfrontation 134
IV Vietnam: Lehren aus der Tragödie 138
1 Das Erbe der kollektiven Sicherheit 140
2 Das Erbe des liberalen Missionseifers 145
3 Das Erbe der Geopolitik 147
4 Das Erbe des konservativen Absolutismus 149
5 Der Aufstieg der Kriegerklasse 153
6 Die Rache des Universalismus x6o
7 Das Ende der Supermächte 166
8 Nach den Supermächten 169
V Studenten heute 176
1 Die neue Universität 176
2 Die neue Generation 179
3 Der internationale Guerillakrieg 183
4 Das Ethos der Jugend 186
5 Die Kluft zwischen den Generationen 189
6 Studentische Mitbestimmung 191
7 Die studentische Linke 194
8 Die Demonstrationen 199
9 Individuelle Werte 202
10 Helden und Hoffnungen 206
VI Neue Wege der amerikanischen Politik 209
1 Die Anatomie der Entfremdung 210
2 Die Neue Politik 213
3 Jefferson und Hamilton 221
4 Vor 1968 228
5 Die Wahl von 1968 232
6 Die Reaktion der Republikaner 235
7 Die Reaktion der Demokraten 239
8 Die Zukunft der Präsidentschaft 245
9 Das Dilemma der Macht des Präsidenten 250



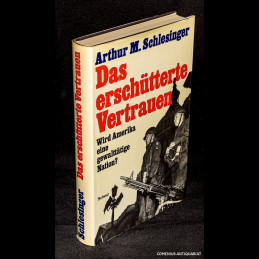
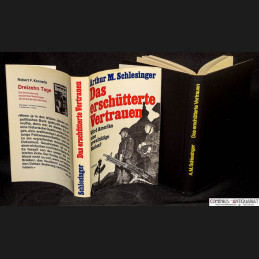

 frais de transport
frais de transport
 Google Mail
Google Mail
