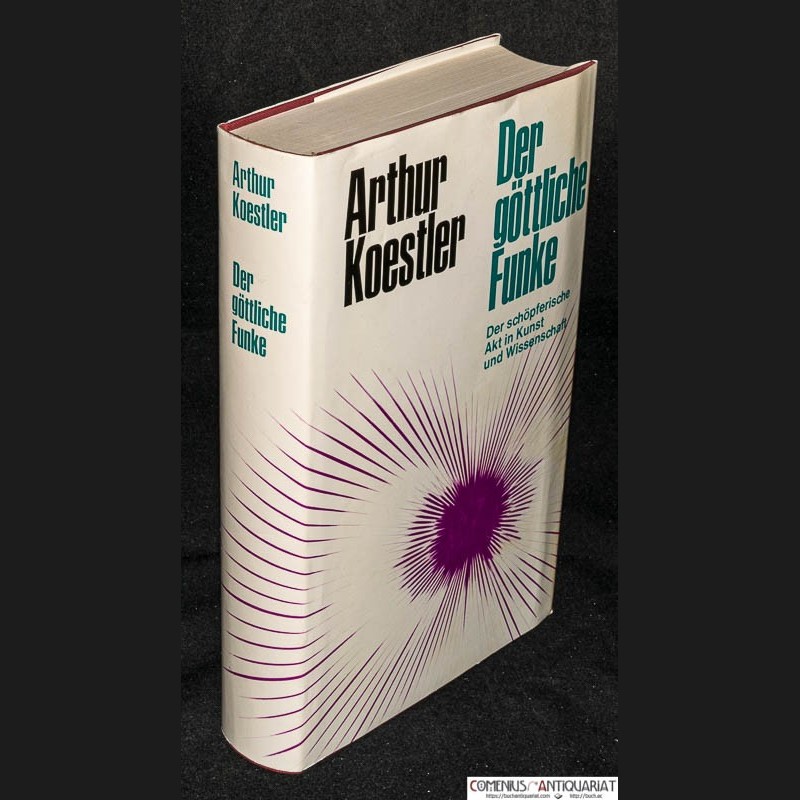Koestler, Arthur,
Der göttliche Funke. Der schöpferische Akt in Kunst und Wissenschaft. Zürich: Neue Schweizer Bibliothek, 1966. 471 Seiten mit Register. Leinen mit Schutzumschlag. 695 g
* Originaltitel: The act of creation; aus dem Englischen von Agnes von Cranach und Willy Thaler. - Leicht gewölbt, Schutzumschlag mit schwachen Gebrauchsspuren.
Bestell-Nr.155135
Koestler |
Psychologie |
Philosophie |
Wissenschaftstheorie
Nicht die Intelligenz allein, sondern ebensosehr das Vermögen zu schöpferischer Leistung geben dem Menschen eine einzigartige Stellung unter den Lebewesen.
Im künstlerischen Schaffen, in der Arbeit des Forschers, in der wissenschaftlichen Tätigkeit oder den zahllosen Spielarten des Humors leuchtet immer wieder jener «göttliche Funke» auf, den der Mensch seit Urzeiten erkannt und zu fassen versucht hat.
Was aber ist das «Schöpferische»? Die einen erklären es als Inspiration oder Intuition, die andern als Scharfsinn oder Gedankenkombination. Kunst mit Gefühl und Wissenschaft mit Verstand gleichzusetzen, ist jedoch ein grober Fehler. Immer stellt eine schöpferische Arbeit — also eine Leistung, die etwas Erstmaliges und Einzigartiges ergibt — eine Verdichtung des Rationalen und Emotionalen dar.
Als Schriftsteller, politischer Psychologe und Naturwissenschaftler besitzt Arthur Koestler aus eigener Erfahrung große Kenntnisse künstlerischer wie naturwissenschaftlicher Arbeitsvorgänge. Er gehört zu den wenigen Menschen, die in unserer Zeit ästhetische und zugleich wissenschaftliche Probleme überschauen und beurteilen können. Dadurch sind diesem Autor die Voraussetzungen gegeben, die Frage nach dem Wesen des «Schöpferischen» zu untersuchen.
Sein «monumentales Buch» (Tagesspiegel) ist ein Vorstoß in die unerforschten Randgebiete der menschlichen Existenz und führt zu grundlegenden Feststellungen, die in ihrer Breite und Tiefe bisher nicht vorlagen. Koestlers Erkenntnisse werden nicht nur die wissenschaftliche Diskussion anregen, sondern auch allen künstlerischen oder wissenschaftlich interessierten Menschen helfen, den Begriff des «Schöpferischen» — für viele bisher der Inbegriff irrationaler Phänomene — zu klären.
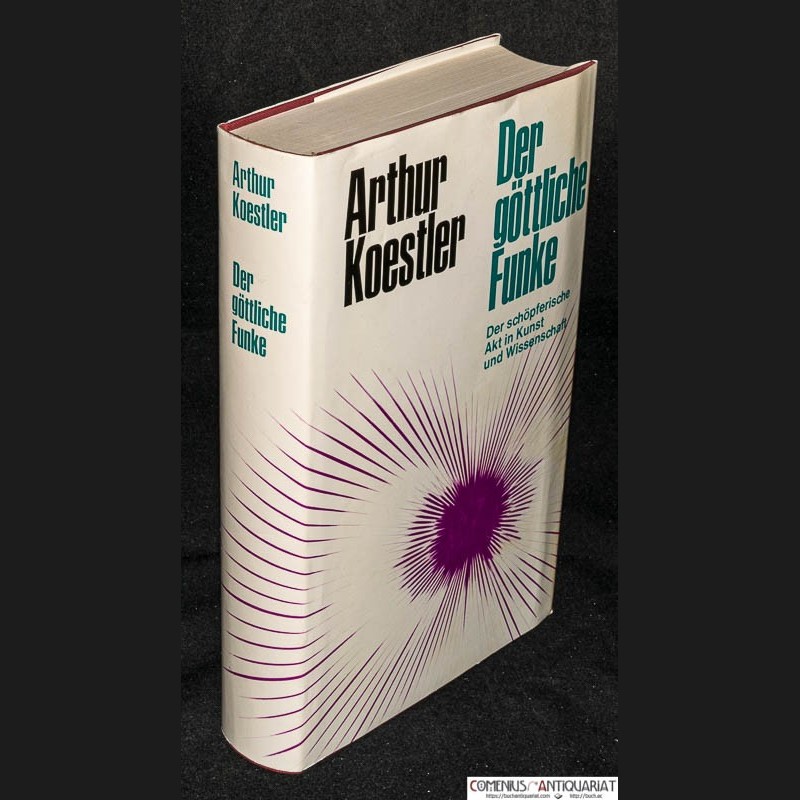
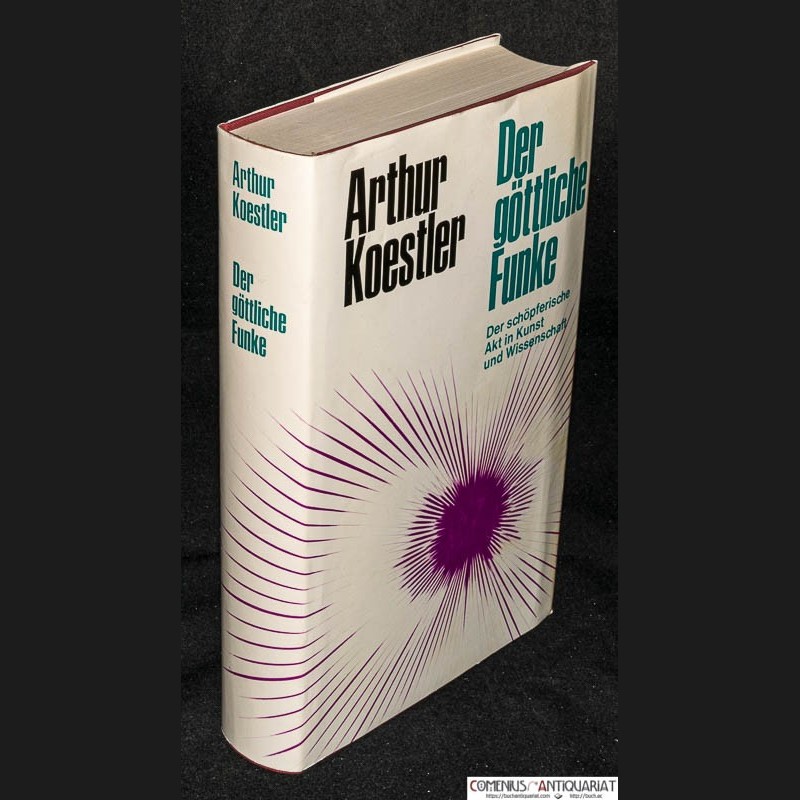
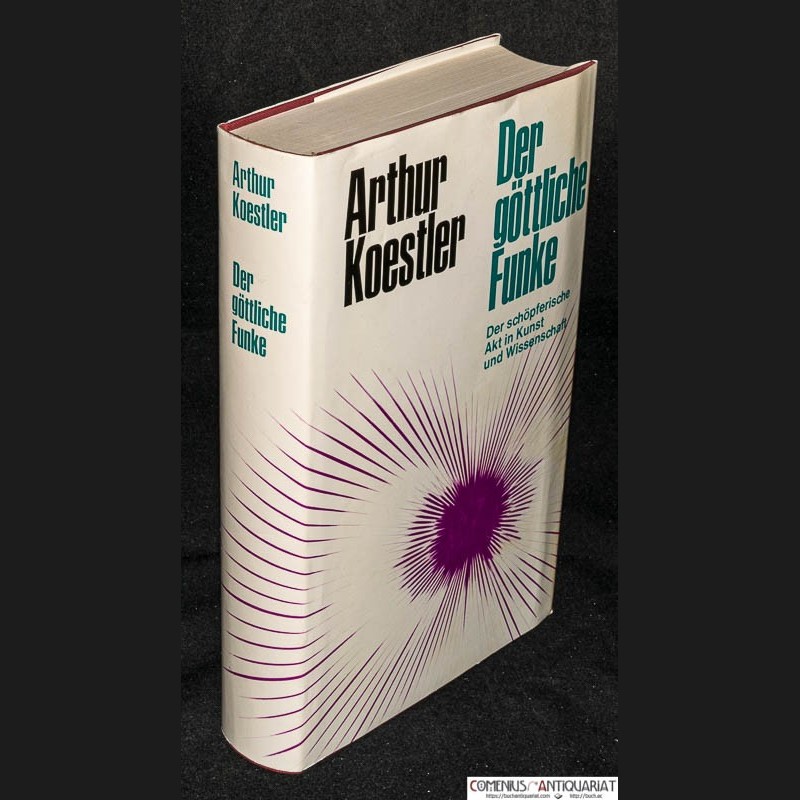
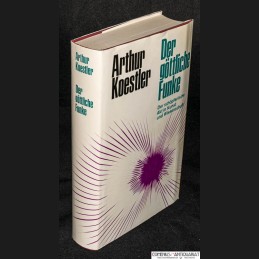
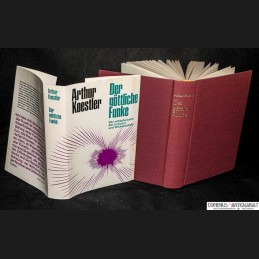
 Privacy
Privacy
 Shipping Costs
Shipping Costs
 Google Mail
Google Mail