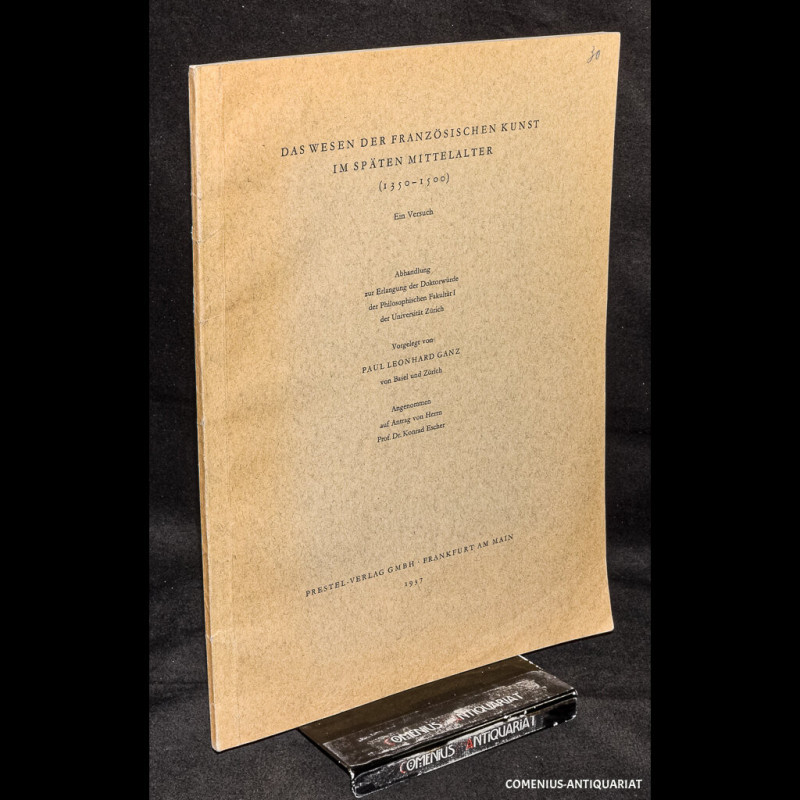Ganz, Paul Leonhard,
Das Wesen der französischen Kunst im späten Mittelalter (1350-1500). Ein Versuch. Frankfurt a. M.: Prestel-Verlag, 1937. 63 Seiten. Broschiert. 4to. 187 g
* Umschlag etwas lichtrandig / gebräunt. Knitterig.
Bestell-Nr.161307
Ganz |
Mittelalter |
Mediaevistik |
Frankreich |
Kunstgeschichte |
Dissertation
# INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
I. ABSCHNITT
Der französische Mensch
Land, Klima, Bodenertrag, Charakterbildung
II. ABSCHNITT
1. Teil: Die Gesetze der Formgebung und des Bildaufbaues
Formgebung: Ruhige Klarheit und Unterteilung der Linie. - Bezüglichkeit und Abstand der Linien unter sich. - Regelmäßige, geschlossene Flächenformen
Bildaufbau: Intuitive Verhältnismäßigkeit und deduktive Einheit. Bestimmte Flächenlage, gegenseitige Bezüglichkeit und Wirkungsflächen der Formkörper. Rolle der Bildachse. Vergleich mit der Heraldik. Beschränkte Anzahl der Aufbauordnungen
Dauernde Gültigkeit der gefundenen Gesetze: Die verhältnismäßige Aufteilung der Bildfläche haftet a) in der begrifflichen Darstellung an den Formkörpern selbst (bzw. an ihren gleicharteten Wirkungslinien); b) im Übergangsstil an den Begrenzungslinien der flächenhaften Hintergrundkulissen; c) in der erscheinungsmäßigen Darstellung an den räumlichen Konstruktionslinien
2. Teil: Die Gesetze der Farbgebung und der Farbanordnung
Veränderliches Verhältnis von Form und Farbe: Ergebnisse der Formbetrachtung gelten grundsätzlich auch für Farbgebung
Dauernde Gültigkeit der Farbgesetze: Die Bezüglichkeit der Farbgebung haftet a) in der begrifflichen Darstellung an den bloßen (begrifflich unterschiedenen) Farbwerten; b) im Übergangsstil an einer begrifflichen Unterscheidung in Erscheinungskategorien; c) in der erscheinungsmäßigen Darstellung an den natürlichen Wirkungswerten
Farbgebung im einzelnen: Weiche Absetzung der Einzelfarben (Angleichung der Hauptfarben, sich ergänzende Nebenfarben, Anklang). Differenziertheit der Tonwerte (Variierung). Farbenauswahl
Verteilungsmöglichkeiten: Unmittelbare und verschränkte Entsprechung, vollständige Verschiedenheit
III. ABSCHNITT
1. Teil: Das Verhältnis von Inhalt und Form
Verbildlichung: Inhalt wirklich (real) begrifflich festgelegt im Zustand des ruhenden Seins. Auswahl der dem Wesen eines Inhalts am besten entsprechenden Stellung in der verbildlichten - Vernünftig-anschauliche Regelung zwischen Inhalt und Form, Wirkungsberechnung. - Übereinstimmung von Formwerten und Inhaltswerten bis ins einzelne (Eindruck von der Wirklichkeit des Inhalts der Form)
a) Den (im Wandel der Zeit veränderlichen) begrifflichen Inhaltseinheiten entsprechen vernünftig-anschauliche Formeinheiten
b) Den (im Wandel der Zeit veränderlichen) inhaltlichen Beziehungen entsprechen - vernünftig-anschauliche - formale Beziehungen
c) Den (im Wandel der Zeit veränderlichen) inhaltlichen Betonungen entsprechen - vernünftig-anschauliche - formale Betonungen. Maßgebend sind: die Form an sich und das Verhältnis zu anderen Figuren; andere Mittel
Inhaltlich-formaler Bildaufbau. Anordnung der Figuren im Gesamtbild (Bildart). Klare Formgestaltung unübersichtlicher Inhalte. - Beschränkung der Inhalte. - Anschaulich-vernünftige Vollständigkeit aller dargestellten Inhalte
2. Teil: Bewegung und Bildgeschehen
Ruhende Bewegungsinhalte. Richtungsausgleich der Bewegungen. Gleichzeitigkeit des Bildgeschehens. Sonderung der Einzelszenen in der mittelalterlichen Szenenreihung. Bildinhalte als einheitlich-ruhende Schaustellungen
3. Teil: Der Bildraum
Anschauliche Raumdarstellung (Konstruktion genügt zur Bildraumklarheit). - Raumbezüglichkeit (Bezüglichkeit der Raumangaben und Begrenzung). - Abschluß nach vorn (Darstellungsmittel: Trennungswände und Verhältnismäßigkeit der Bildinhalte zur idealen Vordergrundsfläche). - Inhaltliche Bedeutung des Raumes. - Raum eine abgekürzte Bühne, ein flächenhaft dargestellter anschaulicher Bildbegriff
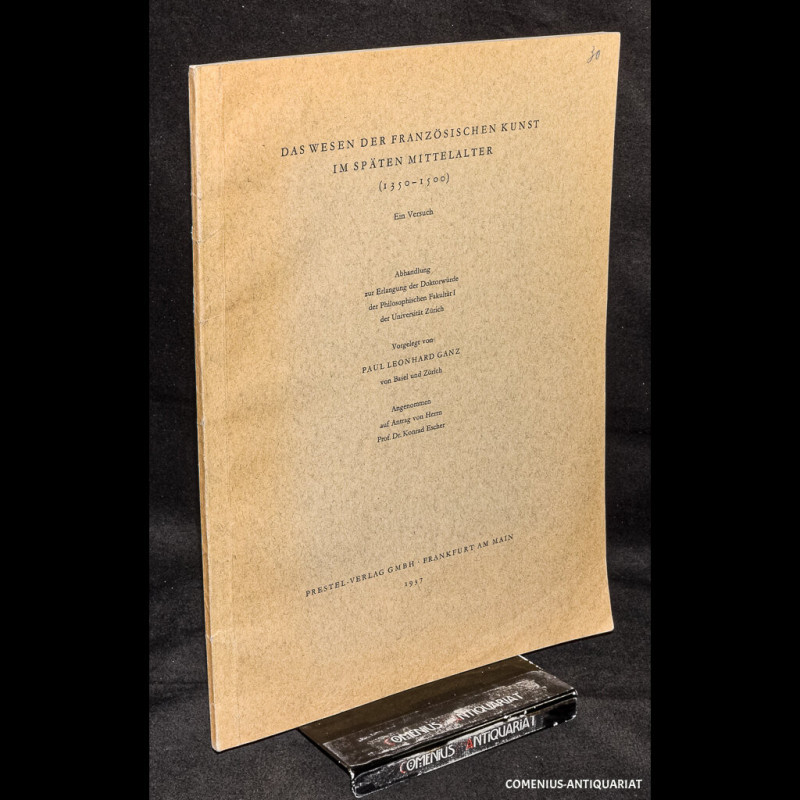
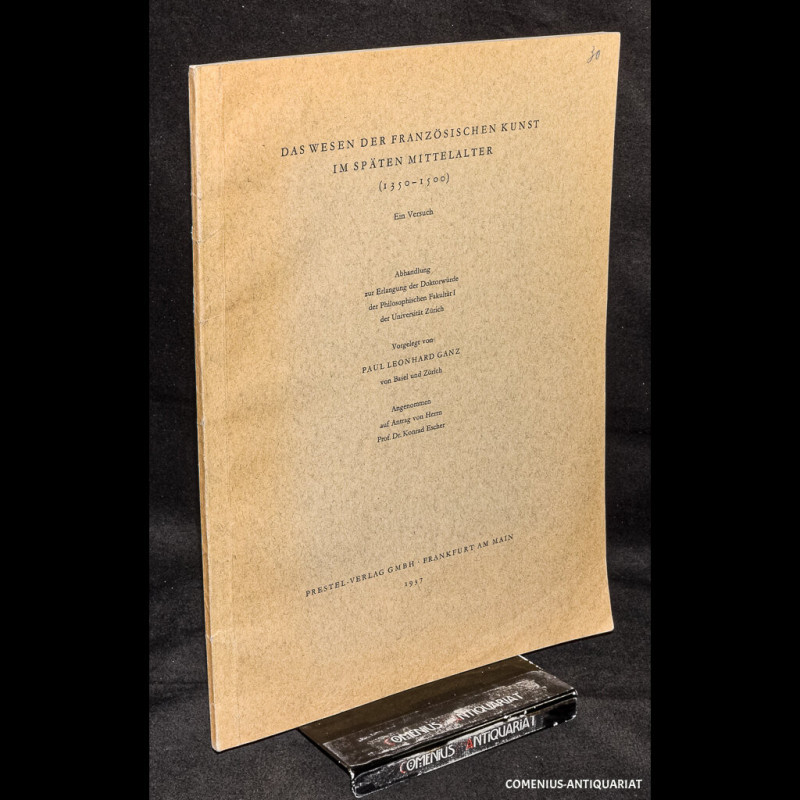
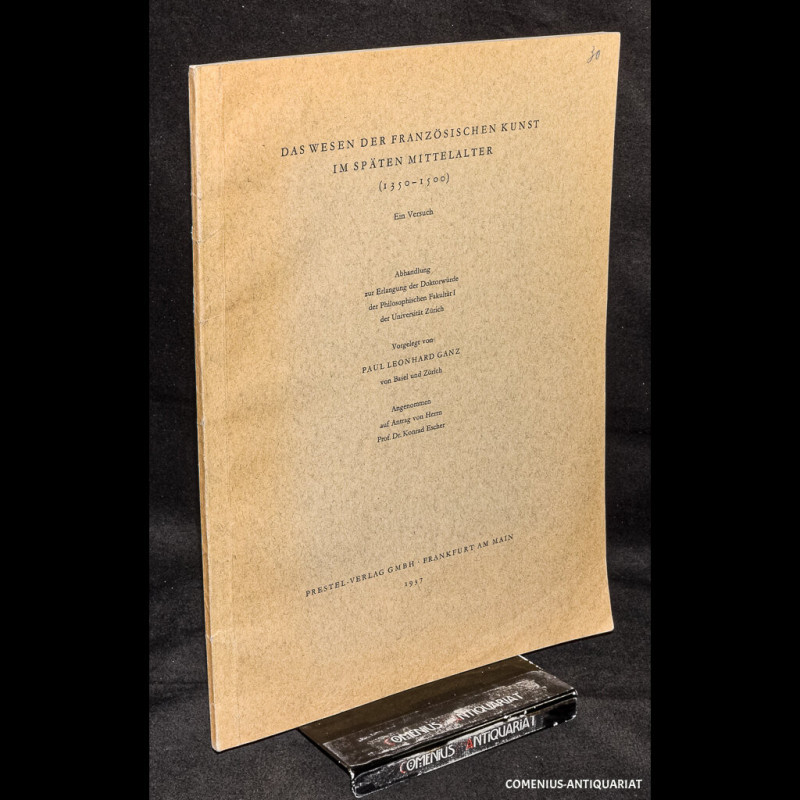

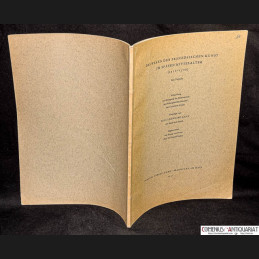
 Privacy
Privacy
 Shipping Costs
Shipping Costs
 Google Mail
Google Mail