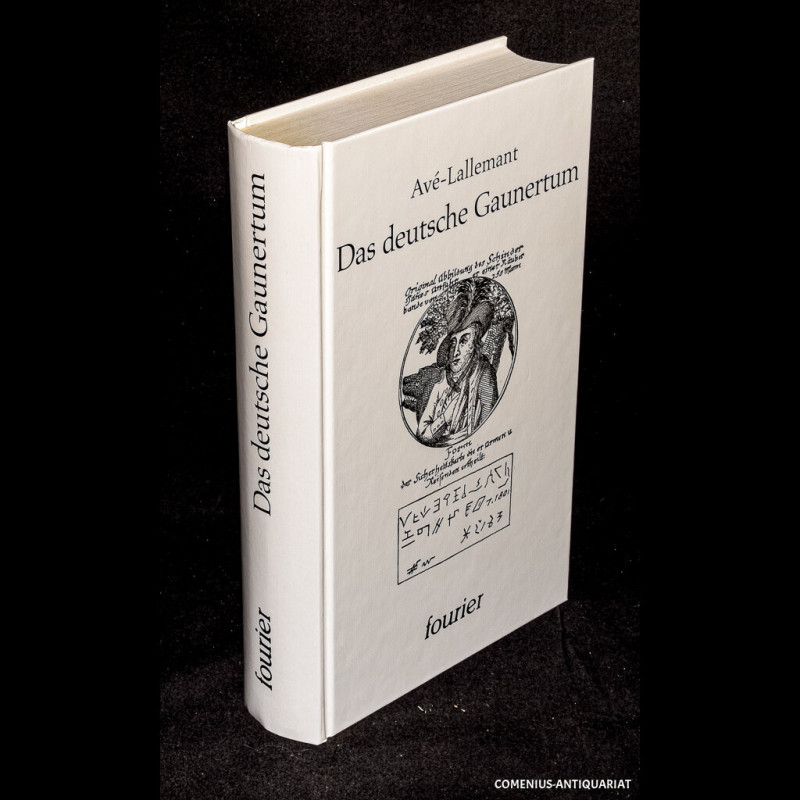Avé-Lallemant, Friedrich Christian Benedikt,
Das deutsche Gaunertum in seiner sozialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestande. Neuauflage. Wiesbaden : Fourier, 1998. Zwei Teile in einem Band. 252, 348 Seiten mit Abbildungen. Pappband (gebunden). 214 x 135 mm. 664 g
* Neuauflage nach der überarbeiteten Ausgabe München, Berlin, 1914 in zwei Bänden.
Bestell-Nr.160566 | ISBN: 3-925037-95-0 | 978-3-925037-95-5
Ave |
Soziologie |
Literaturgeschichte |
Gauner |
Sozialgeschichte |
Germanistik
Inhalt des ersten Teils
Erster Abschnitt
Das historische Gaunertum
Erstes Kapitel: Einleitung: Allgemeiner Begriff des Gaunertums 9
Zweites Kapitel: Etymologische Ableitung des Wortes „Gauner" 12
Drittes Kapitel: Die Elemente des deutschen Gaunertums 19
Viertes Kapitel: Erstes Auftreten der Juden in Deutschland 22
Fünftes Kapitel: Erstes Auftreten der Zigeuner in Deutschland 26
Sechstes Kapitel: Entwicklung des deutschen Bettler- und Gaunertums 35
1 Das deutsche Heidentum 35
Siebentes Kapitel:
2 Das Bettler- und Gaunertum seit Einführung des Christentums in Deutschland 37
Zweiter Abschnitt
Literatur des Gaunertums
Achtes Kapitel: Einleitung und Übersicht 113
Neuntes Kapitel: Das Baseler Ratsmandat
Brants „Narrenschiff" und Geilers „Predigten" 117
Zehntes Kapitel: Der Liber Vagatorum und die Rotwelsche Grammatik 130
Elftes Kapitel: Pamphilus Gengenbach und die poetische Gaunerliteratur 194
Zwölftes Kapitel: Die Anekdoten, Biographien und Schelmenromane 201
Dreizehntes Kapitel: Die Relationen 206
Vierzehntes Kapitel: Die freiere psychologische Bearbeitung und rationelle Darstellung 224
Fünfzehntes Kapitel: Die Gruppen- und Personenskizze 230
Inhalt des zweiten Teils
Dritter Abschnitt
Das moderne Gaunertum
Die Repräsentation des Gaunertums
Erstes Kapitel: Die persönlichen und sozialen Verhältnisse 1
Zweites Kapitel: Psychologische Wahrnehmungen 12
Das Geheimnis des Gaunertums
Das Geheimnis der Person
Drittes Kapitel: Die gaunerische Erscheinung 27
Viertes Kapitel: Die Simulationen 31
Fünftes Kapitel: Die körperlichen Entstellungen und ihre künstlichen Merkmale 32
Sechstes Kapitel: Die Schwangerschaft 34
Siebentes Kapitel: Die Epilepsie 35
Achtes Kapitel: Die Taubstummheit 37
Neuntes Kapitel: Die Schwerhörigkeit 39
Zehntes Kapitel: Geisteskrankheiten 40
Elftes Kapitel: Affekte 41
Das geheime Verständnis
Zwölftes Kapitel: Die Gaunersprache 41
Dreizehntes Kapitel: Das Zinken 42
Vierzehntes Kapitel: Die Jadzinken 43
Fünfzehntes Kapitel: Die Kenzinken 44
Sechzehntes Kapitel: Die graphischen Zinken 47
Siebzehntes Kapitel: Die phonischen Zinken 53
Achtzehntes Kapitel: Die Sslichnerzinken 54
Neunzehntes Kapitel: Die Gaunernamen 55
Zwanzigstes Kapitel: Der Zinkplatz 58
Einundzwanzigstes Kapitel: Der Vertuß 60
Zweiundzwanzigstes Kapitel: Das Schrekenen 61
Dreiundzwanzigstes Kapitel: Das Meistern 62
Vierundzwanzigstes Kapitel: Das Zuplanten 64
Fünfundzwanzigstes Kapitel: Das Brennen 67
Sechsundzwanzigstes Kapitel: Das Maremokum 69
Siebenundzwanzigstes Kapitel: Das Kaßpern 70
Achtundzwanzigstes Kapitel: Das Pißchen-pee 71
Neunundzwanzigstes Kapitel: Das Challon-Kasspem 72
Dreißigstes Kapitel: Die Kutsche 74
Einunddreißigstes Kapitel: Die Kassiwer 75
Zweiunddreißigstes Kapitel: Das Hakesen 80
Dreiunddreißigstes Kapitel: Das Baldowern 84
Vierunddreißigstes Kapitel: Die Kawure 89
Die Gaunerpraxis
Fünfunddreißigstes Kapitel:
Die allgemeine Praxis und Terminologie 95
Die spezielle Praxis Das Schränken
Sechsunddreißigstes Kapitel Der Verschluß im weiteren Sinne 98
Siebenunddreißigstes Kapitel: Der Einbruch, Unterkabber,
Aufbruch und die Hilfsmittel dazu 99
Achtunddreißigstes Kapitel: Das Pegern 109
Neununddreißigstes Kapitel Die Zeit, die Kohlschaft und die goldene Choschech 110
Vierzigstes Kapitel: Die Schmieren und Lampen
Einundvierzigstes Kapitel: Das Massemattenhandeln 111
Zweiundvierzigstes Kapitel: Der Rückzug 112
Dreiundvierzigstes Kapitel: Die Kawure, der Intippel und die Cheluke 116
Vierundvierzigstes Kapitel: Spezielle Arten und Terminologien des Schränkens 117
Fünfundvierzigstes Kapitel: Das Pleitehandeln und das Challehandeln 118
Sechsundvierzigstes Kapitel: Der Schutz gegen das Schränken
Das Makkenen 120
Siebenundvierzigstes Kapitel: Der Verschluß im engeren Sinne
Das Makkenen und seine Terminologien 123
Achtundvierzigstes Kapitel:
Das Schloß, der Schlüssel und seine Bewegung 127
Neunundvierzigstes Kapitel:
Die Kunst und die Kunstmittel der Makkener 133
Fünfzigstes Kapitel:
Die Verbesserungen von Chubb, Bramah und Newell 143
Einundfünfzigstes Kapitel: Das Makkenen auf Kittenschub 147
Zweiundfünfzigstes Kapitel:
Das Kittenschieben: Erklärung und Terminologien 149
Dreiundfünfzigstes Kapitel:
Arten des Kittenschiebens Die Zefirgänger 150
Vierundfünfzigstes Kapitel: Die Erefgänger 152
Fünfundfünfzigstes Kapitel: Die Kegler 154
Sechsundfünfzigstes Kapitel: Die Merchitzer 154
Siebenundfünfzigstes Kapitel: Das Schottenfellen 155
Achtundfünfzigstes Kapitel: Das Chalfenen 162
Neunundfünfzigstes Kapitel:
Das Ennevotennemachen oder Chassimehandeln 165
Sechzigstes Kapitel: Das Neppen 166
Einundsechzigstes Kapitel:
Das Viaschmahandel oder das Polengehen 169
Zweiundsechzigstes Kapitel: Das Merammemooßmelochnen
oder Linkenesummemelochnen 170
Dreiundsechzigstes Kapitel:
Der Konehandel oder das Blütenschmeißen 172
Vierundsechzigstes Kapitel: Das George-Plateroon 173
Fünfundsechzigstes Kapitel: Der Pischtimhandel 176
Sechsundsechzigstes Kapitel: Das Stippen 177
Siebenundsechzigstes Kapitel:
Das Torfdrucken oder Cheilefziehen 178
Achtundsechzigstes Kapitel:
Das Stradehandeln, Goleschächten oundr Golehopfen 186
Neunundsechzigstes Kapitel:
Das Jedionen Etymologische Erklärung 194
Siebzigstes Kapitel: Das Wahrsagen 196
Einundsiebzigstes Kapitel: Das Kelefen 201
Zweiundsiebzigstes Kapitel: Das Schocher-majim 203
Dreiundsiebzigstes Kapitel: Der Erbschlüssel 205
Vierundsiebzigstes Kapitel: Das Sefelgraben 207
Fünfundsiebzigstes Kapitel: Die Rochlim 209
Sechsundsiebzigstes Kapitel: Das Zchokken oder Freischuppen 213
Siebenundsiebzigstes Kapitel: Das Haddern 215
Achtundsiebzigstes Kapitel: Das Kelosim-Zinkenen 217
Neunundsiebzigstes Kapitel: Das Kelosim-Mollen 218
Achzigstes Kapitel: Die neue Fahrt 220
Einundachzigstes Kapitel:
Das Kuwiostoßen: Das Würfelschleifen 221
Zweiundachzigstes Kapitel: Jung und alt 222
Dreiundachzigstes Kapitel: Die Sanduhr 223
Vierundachzigstes Kapitel: Der Scheffel 225
Fünfundachzigstes Kapitel: Das Deckeies 226
Sechsundachzigstes Kapitel:
Das Riemenstechen oder Bandspiel 227
Siebenundachzigstes Kapitel: Die Glücksbuden 228
Achtundachzigstes Kapitel: Das Fleppenmelochnen 230
Neunundachzigstes Kapitel: Das Schärfen und Paschen 242
Neunzigstes Kapitel: Der Intippel und die Spieße 249
Die Paralyse des Gaunertums
Einundneunzigstes Kapitel: Die französisch-deutsche Polizei 259
Zweiundneunzigstes Kapitel: Der Widerspruch zwischen der
französischen Polizeigewalt und dem Volke 260
Dreiundneunzigstes Kapitel: Die Verständigung
des deutschen Bürgertums mit der Polizeigewalt 264
Vierundneunzigstes Kapitel: Die Versetzung
der deutschen Polizei mit der französischen Polizei 267
Die Aufgabe der deutschen Polizei
Fünfundneunzigstes Kapitel: Der allgemeine Notstand 270
Sechsundneunzigstes Kapitel:
Die Errichtung von Lehrstühlen des Polizeirechts 272
Siebenundneunzigstes Kapitel:
Die Zentralisation und Repräsentation der Polizeigewalt 273
Achtundneunzigstes Kapitel:
Die Modifikation der militärischen Organisation der Polizei 275
Neunundneunzigstes Kapitel: Die Reform der Bureaus 276
Hundertstes Kapitel: Die Beseitigung des Vigilantenwesens 279
Hundertunderstes Kapitel: Die Geltung des Vorgesetzten
und die Befähigung der Unterbeamten 280
Hundertundzweites Kapitel:
Die Verständigung der Polizei mit dem Bürgertum 282
Hundertunddrittes Kapitel: Die Verfolgung des Gaunertums 283
Hundertundviertes Kapitel: Die Gauneruntersuchung 286
Hundertundfünftes Kapitel: Schlußwort 298
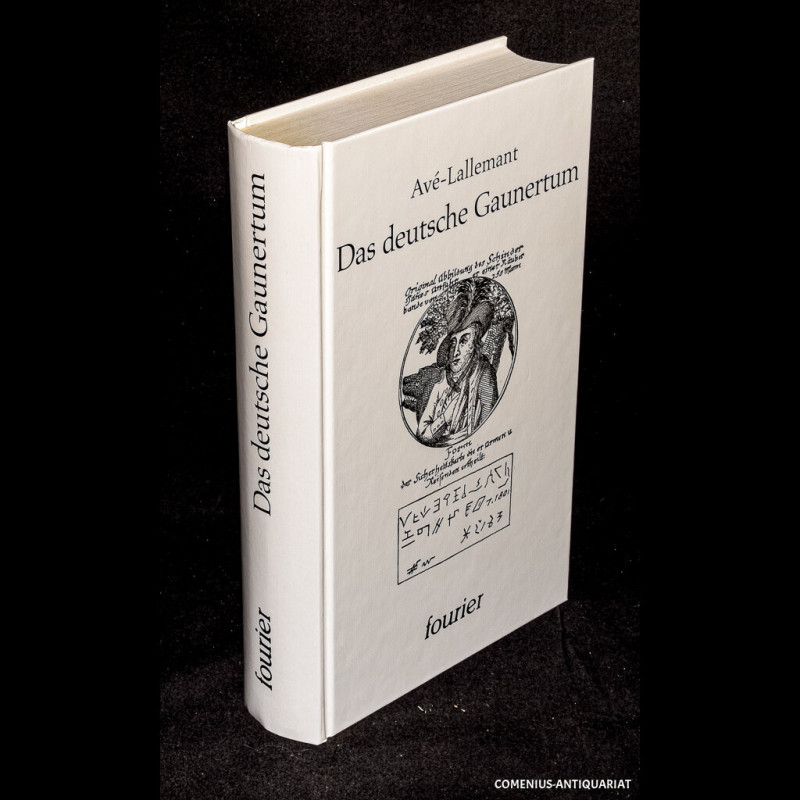
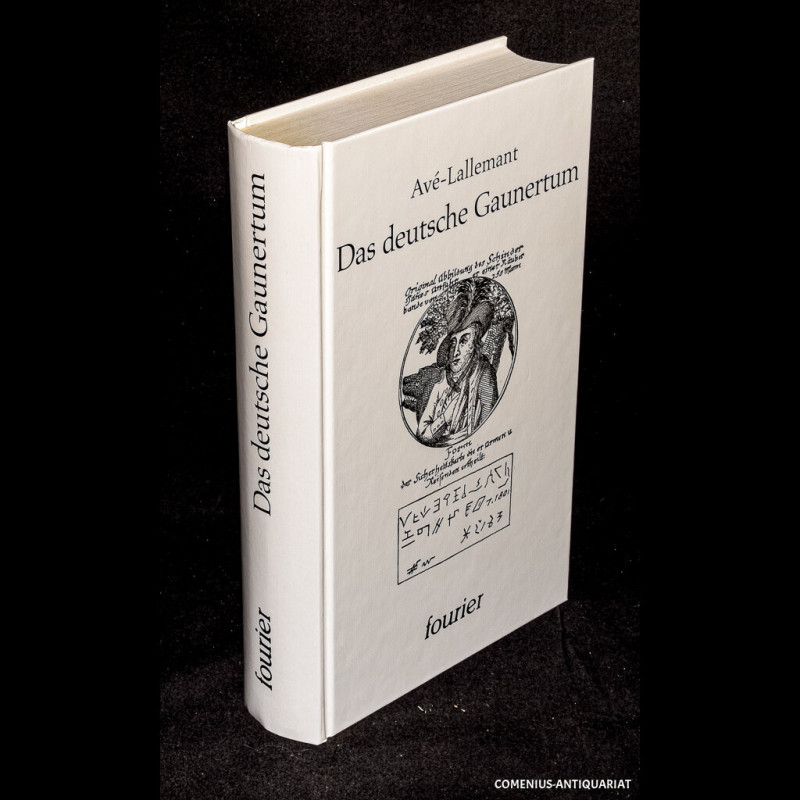




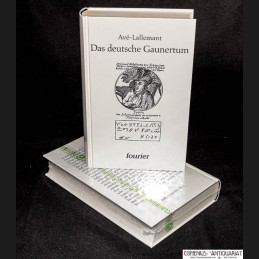
 Privacy
Privacy
 Shipping Costs
Shipping Costs
 Google Mail
Google Mail