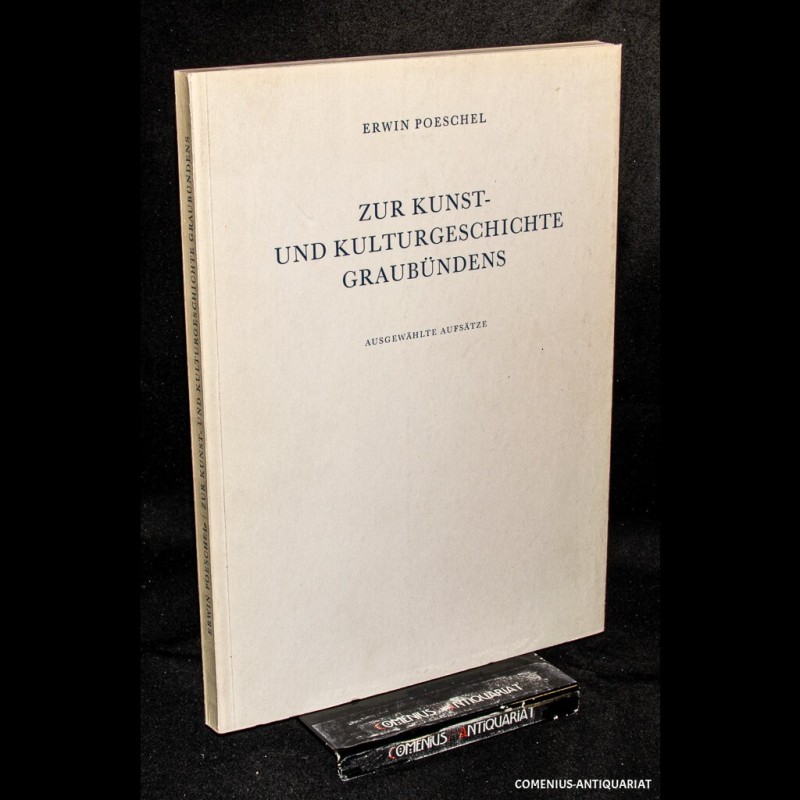Poeschel, Erwin,
Zur Kunst- und Kulturgeschichte Graubündens. Ausgewählte Aufsätze. Zürich: Berichthaus, 1967. 188 Seiten mit Abbildungen auf Tafeln, Literaturverzeichnis und Register. Kartoniert (Klappenbroschur). 4to. 264 x 195 mm. 466 g
* Herausgegeben von der Gesellschaft für schweizerische Kunstgeschichte. - Umschlag mit schwachen Gebrauchsspuren.
Bestell-Nr.158446
Poeschel |
Kunstgeschichte |
Helvetica |
Schweiz |
Raetica |
Graubuenden
SPRACHE UND KUNSTGESCHICHTE
Statt eines Vorwortes
Der Gedanke lag irgendwie in der Luft: Redaktor Martin Risch von der Schweizerischen Bauzeitung sprach ihn erstmals aus. Die Idee zündete: bei den Mitarbeitern des Schweizerischen Institutes für Kunstwissenschaft, bei den daraufhin angesprochenen Erben von Dr. h. c. Erwin Poeschel und ihrem Vertreter Dr. Simon Jegher, bei der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, bei allen, die wir in irgendeiner Form gebeten haben, beizutragen zur Neuherausgabe ausgewählter Aufsätze zur Kunst- und Kulturgeschichte Graubündens. Was aber würden Sie, lieber verstorbener Freund Erwin Poeschel, zu diesem Unterfangen selbst gesagt haben? Ich sehe Ihre abweisende Handbewegung. Wenn wir die Kreise Ihrer Bescheidenheit und Selbstkritik tangierten, dann konnten Sie zwar höflich, aber unmißverständlich Einhalt gebieten. Doch gestatten Sie mir bitte ein Wort der Entgegnung: So sehr wir gerade die weitgespannten humanistischen Grundlagen Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, die universellen Bezüge Ihres Wissens bewundert und Ihnen weiteste Kompetenz eingeräumt haben, hier erlauben wir uns eine beträchtliche Einschränkung: hier irrt Poeschel! Natürlich hat der eine oder andere Gesichtspunkt als heute weniger wichtig oder als überholt zu gelten, ist das Feld unterdessen möglicherweise etwas weiter oder präziser abgesteckt worden. Der Pegel des Wahrheitsgehaltes mag schwanken, mag etwas fallen; Persönliches beginnt vielleicht zu verblassen. Was aber so viele Ihrer kunst- und kulturwissenschaftlichen Leistungen den üblichen Verlustlisten zeitbedingter Produktion enthebt, das ist nicht allein die Fülle des genau und in diesen Konstellationen einmalig erfaßten Stoffes. Es ist nicht ausschlaggebend allein das, was Sie zusammentrugen, sondern auch die Kunst, mit der Sie es zu sagen verstanden. Die Schilderung des Kunstwerkes haben Sie durch die sprachliche Gestalt selbst zur kunstreich gestalteten Sprache, zum wertdauernden Kunstwerk erhoben. Die Sprache ist, so finden wir es in einem der nachfolgenden Aufsätze formuliert, nicht nur ein technisches Verständigungsmittel. Vielmehr wirkt sie «zurück auf den Geist dessen, der sich ihrer bedient, formt die Art seines Denkens, vermittelt ihm Vorstellungsinhalte ». Der Beweis liegt vor uns in Sätzen etwa wie den folgenden: «Kirche und Burg — das Herz des Mittelalters und seine Faust!» Oder: Die Churer Kathedrale, «die den Eintretenden wie eine mächtige Felsenhöhle umfängt und deren ungefüge Plastiken noch halb im Urschlaf eines archaischen Zustandes befangen zu sein scheinen ». Der Leser dieses schlanken und dennoch gewichtigen Buches begegnet solcher Bildhaftigkeit auf Schritt und Tritt und staunt, wie Poeschel seine Wahlheimat Graubünden nicht als distanzierter Gast aus schwäbischen Perspektiven mit allen Möglichkeiten des Mißverstehens anvisieren muß, nicht als zutiefst doch fremd gebliebener Einwanderer und kultureller Kolonist, sondern wie er als vollgültiger Anwalt der Kunst und Geschichte mitten aus dem Herzen des Landes hat künden dürfen. Von Wunder und Wesen der Assimilation sprach er im hier auch wiedergegebenen, 1937 gehaltenen Zürcher Volkshochschulvortrag über die Kunst in der rätoromanischen Schweiz: «Es geht, wie es mit der Rebe der Bündner Herrschaft kam. Sie wurde von Herzog Rohan in diesem Landstrich, den er so sehr liebte, aus Burgund eingeführt, aber sie spendet hier einen andern Wein als dort, von strengerem Geiste und herberen Düften. » und noch deutlicher da, wo Poeschel vom Import schwäbischer Schnitzaltäre schreibt, wo er /vier, mingen und Ravensburg nennt, die seiner Heimat Kempten so nahe liegen: da wirkte riebe äußern Umständen wohl mit, daß die Gefühlslage gerade der schwäbischen Kunst im bündne. rischen Empfinden Widerklang fand. Denn besinnlich — und in der Kundgebung des Gefühls zurückhaltend — zwischen der leichteren Art des Westens und dem schäumenden bayerischen Temperament in der Mitte stehend, mußte sie sich mit dem bündnerischen Naturell am leichtesten verständigen können. » Das stark Malerische und Gefühlsbetonte aus nordischen Räumen trifft hier auf die läuternde Latinität, das SchattigVersponnene wird durchlichtet von Italianitä, das Wellenspiel der Kulturen streicht über Gebrigskämme der tausend Täler hinüber, herüber, bis jeweilen das bewährte eigenständige Gleichgewicht gefunden erscheint und phrasenlos gelassenselbstsichere Gestalt gewinnt. Das Verständnis für den Ausdruckswert gedrungener Massen paart sich mit dem Sinn für Ebenmaß und Gliederung. Dissonierendes erfüllt seinen Zweck nur in der Auflösung im bel canto. Südliche Winde umfächeln hier auch die Kunst des Nordens. Dies alles entsprach Poeschels maßhaltendem, auf Klarheit zielendem und auf Ausgleich bedachtem Wesen. Und da habe ich mich schon zu seinen Lebzeiten nach manchem Besuch in seinem Zürcher Heim an der Drusbergstraße gefragt, wie sich die dort überall aufgehängten Werke Augusto Giacomettis dazu fügen. Beziehungen etwa zu Carigiet oder zum Zürcher Bodmer schienen mir da einfach näherzuliegen als die farbtrunkene Art Giacomettis, den wir eben wieder als ersten Wegbereiter ungegenständlicher, ja tachistischer Malerei neu zu entdecken und zu loben uns anschicken. Erwin Poeschels Arbeiten über Giacometti und seine Kunst, die schöne Monographie, die er ihm gewidmet hat, sie gelten nicht dem Farbekstatischen und Exzeßhaften. das man in diesem einzigartigen Werke festzustellen liebt. Sie gelten nicht allein der edelsteinfeurigen Welt des schönen Scheines, die Giacometti über den Trübungen des Alltags aufbaut. der «leuchtenden Kuppel von Träumen und festlichem Glanz », einer Märchenwelt, in welcher der Künstler «vollkommen unschuldvoll » sich einspinnen kann, sie gelten auch hier dem «Zwang des Gesetzes von Maß und Zahl », die in rein farbig organisierte Flächen übertragen erscheinen, der «magischen Formel des Gleichgewichtes» in der Verteilung der Werte im Spiel der Farbbegegnungen, Steigerungen und Höhepunkte. Zum 6o. Geburtstage Giacomettis lesen wir: «Sein Wesen ist bestimmt durch eine glückliche Verbindung von Träumerei, der Lust am Spiel freischwebender Phantasie mit jener Bedächtigkeit und innerer Sicherheit, die ein Erbe seines bündnerischen Naturells ist. » Also doch und wieder «das Bündnerische ». Die Aufsätze zu Giacometti zeigen im Grunde keinen fremden Zirkelschlag der Gedanken; sie gehören innerlich durchaus zur Anthologie und zur Laudatio Bündens, die so strahlend über der Folge dieser Aufsätze erglänzt und manchen Leser über den längst vermißten Überblick im ersten Bündner Kunstdenkmälerband vorläufig hinwegzutrösten vermag. Einen besondern Hinweis erlaubt aber Poeschels Stellung zu Giacomettis Farbenwelt dennoch. Es ist das Grenzland, das zwischen Zuständen Schwebende und Vibrierende. sind etwa die Glasgemälde, die «einem Zwischengebiet von Festem und Fließendem angehören », die als großes Abenteuer des Geistes ihn immer wieder besonders anzuziehen vermochten. Da. wo er die Schönheit der bündnerischen Burgruinen preist, deren Gemäuer «nicht mehr Form und noch nicht Formlosigkeit» bedeuten. Da, wo er den kunstreich angelegten Garten beim Palazzo Donats in Sils dem vegetativ Wuchernden beim Bothmar von Malans gegenüberstellt oder wo er an Goethes Klage beim Abschied aus Rom erinnert: «In Rom wurde kein Stein mehr angesehen, wenn er nicht gestaltet war. Die Form hatte allen Anteil an der Materie verdrängt. Jetzt wird eine Kristallisation schon wieder wichtig und ein unförmlicher Stein zu etwas. » Nur für eines hat Poeschel in seiner musikalisch leicht' fließenden Sprache nie Verständnis aufgebracht, für das Gestrüpp der Worte und das Gehaspel der Sätze. Hier ließ er sich von lateinischer Übersichtlichkeit keinen Zoll abhandeln. Im formalen Gleichklang von Gegenstand und Wort, das ihn umschreiben und aufschlüsseln soll, erblickte er eine unabdingliche Verpflichtung des Kunsthistorikers gegenüber dem Kunstwerk. Der Kreis, den wir zu Anfang unserer Gedankengänge zu umschreiten begonnen haben, beginnt sich harmonisch zu schließen. Es ist wohltuend, auch auf diesem Gebiete dem Durchgestalteten zu begegnen — in einer Zeit, die allzu leichtfertig im Rohen schon das Vollendete zu erkennen glaubt und im bloß Gequälten das Tiefsinnige vorgibt. Mag uns auch vieles faszinieren, was in der Kunstgeschichtsschreibung mit breitester Kohle skizziert, im Strich nicht selten zufällig und im ganzen oft unzulänglich und nur forsch hingeschmissen erscheint. Zu den dauernden Werten jedenfalls werden unangefochten jene Bilder zählen, die mit der Präzision des Silberstiftes nachvollzogen und behutsam und liebevoll durchgestaltet worden sind.
Albert Knoepjli
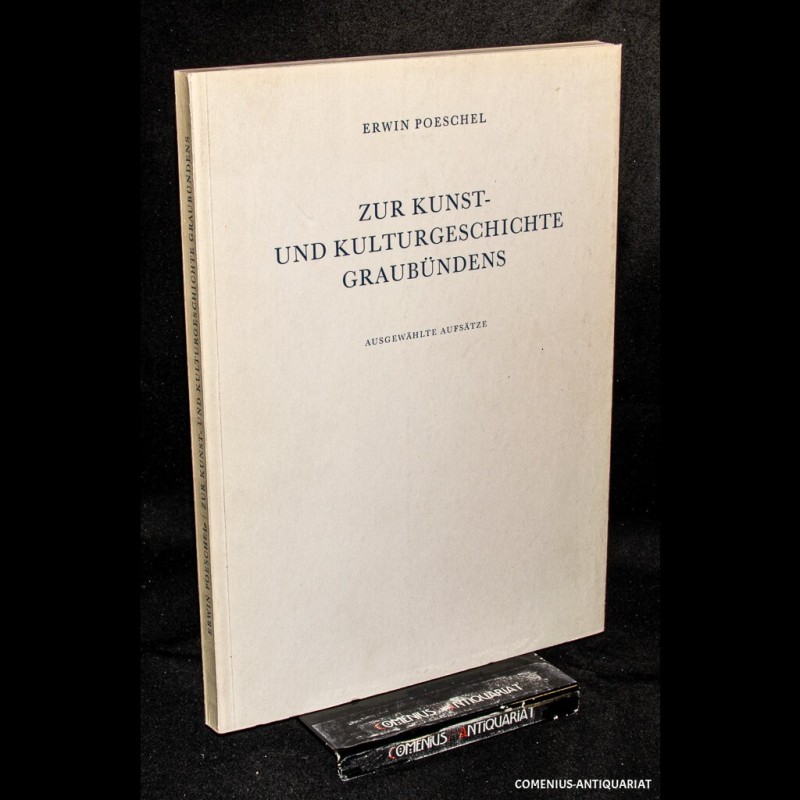
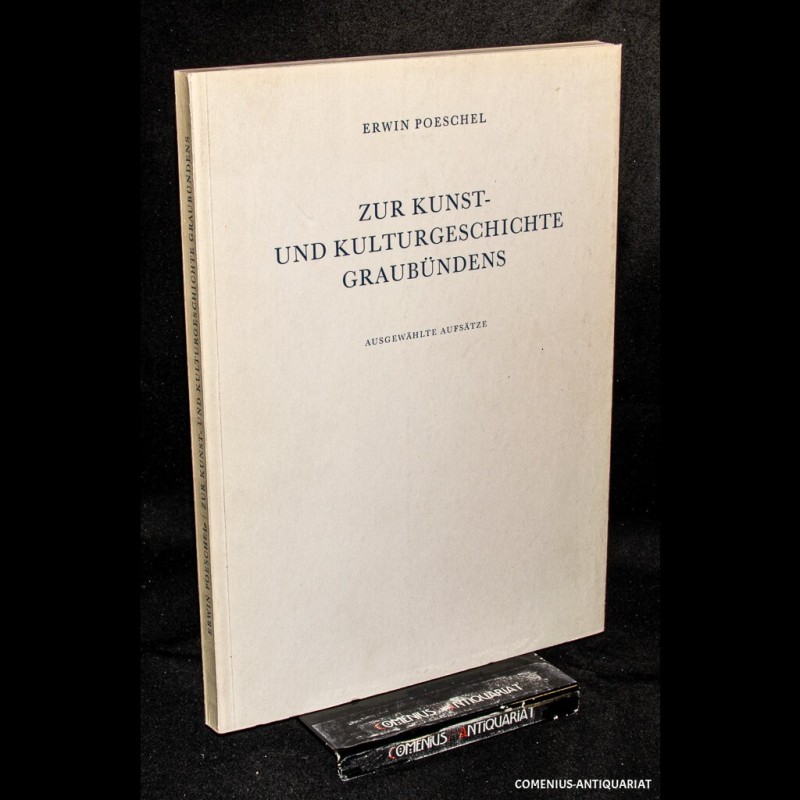
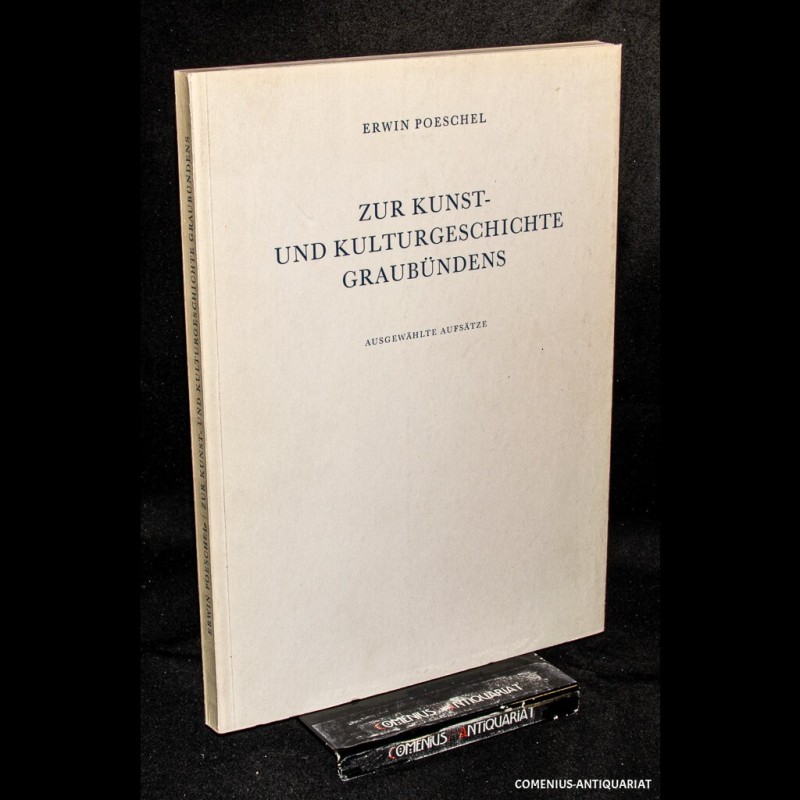

 Privacy
Privacy
 Shipping Costs
Shipping Costs
 Google Mail
Google Mail