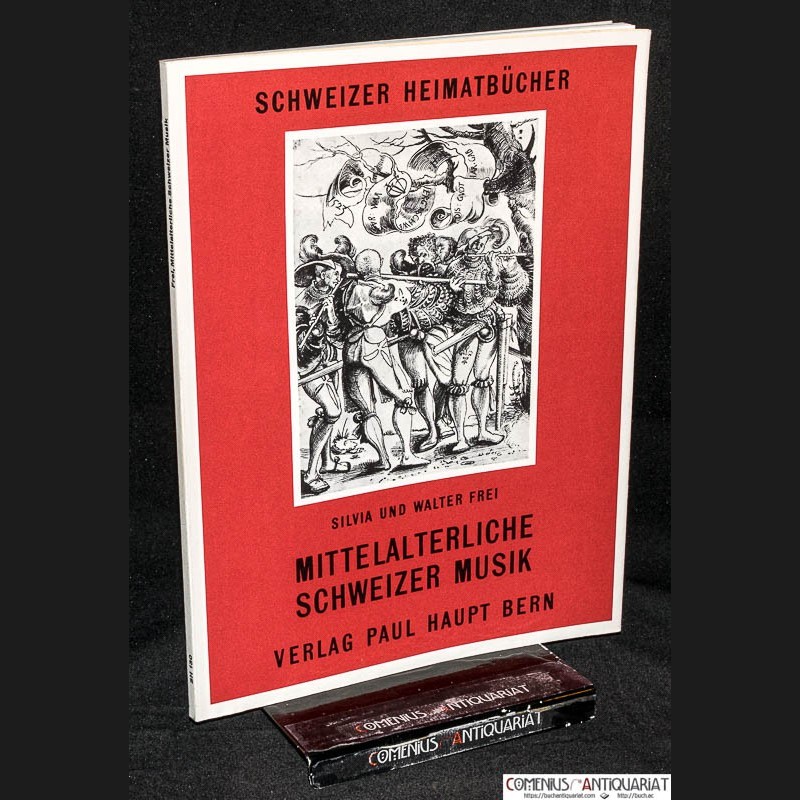Frei, Silvia und Walter,
Mittelalterliche Schweizer Musik. Bern: Haupt, 1967. 55 Seiten mit Seiten 25 - 55 Abbildungen und einer Falttafel. Englische Broschur. Grossoktav. 188 g
* Schweizer Heimatbücher, 130
Bestell-Nr.156335
Frei |
Mittelalter |
Mediaevistik |
Helvetica |
Schweiz |
Musik
Das Mittelalter steht im schweizerischen Gedächtnis als ehernes Zeitalter unseres Landes da, und ruhmreicher Waffenlärm übertönt selbst im Ohr des Geschichtskundigen den Klang der Musik. Dennoch ging damals nichts Alltägliches und nichts Besonderes am Menschen vorüber ohne Gesang und Spiel: bei Gotteslob und Tanz, bei Arbeit und Feier, bei
Geselligkeit und in einsamen Stunden i— zu Stadt und Land, in Klöstern und Burgen, auf
Weiden und Straßen, in Werkstätten und Stuben ließ Musik als Harmonie aus heiler Welt
die Sterblichen aufhorchen auf das, was über allen bloßen Zwecken steht und darum das
Dasein mit Sinn zu erfüllen vermag.
Zwar können wir mit Bestimmtheit annehmen, daß die Musik schon im römischen Helvetien, zumal in den Theatern von Augusta Raurica, Vindonissa und Aventicum, eine Rolle
gespielt hat, doch fehlen uns von jener Epoche alle entsprechenden historischen Dokumente.
Erst aus der Zeit nach der Völkerwanderung, da das Gebiet der Schweiz besiedelt war
von Alemannen, Burgundern, Langobarden und Rätern, ist durch die mündliche Überlieferung des Bündner Oberlandes als einziges und daher ungewöhnlich kostbares Zeugnis
die Canzun de sontga Margriata erhalten geblieben. Das Lied wurde bis in unser Jahrhundert hinein von den Bäuerinnen beim Jäten des Gartens und beim Spinnen der Wolle
gesungen, dabei gewiß sprachlich dem jeweiligen Wachstum des Romontsch angeglichen,
so daß es uns im heutigen Dialekt der Surselva vorliegt aber sachlich ist offensichtlich
seit dem Frühmittelalter weder im Textlichen noch im Musikalischen erheblich geändert
worden. Nicht ausgeschlossen scheint, daß der herbe Rezitationston in jene Zeit zurückreicht, da der Choralgesang der missionierenden Mönche in den einsamen Tälern noch
nicht den Gekreuzigten verkündete, und der Inhalt des volkstümlichen Epos ist durchaus heidnisch.
Unter dem Namen «heilige Margret» verrichtet auf einer Alp am Kunkelspaß eine Erdgottheit Dienst als Zusenn. Wie sie aber vom Hirtenknaben entdeckt wird und dieser dem
numinosen Zwang verfällt, das Geheimnis verraten zu müssen, nimmt die «Heilige»
Abschied aus der Gegend, und mit ihr verläßt die sagenhafte Fruchtbarkeit einer goldenen
Vorzeit das Tal des jungen Rheins für immer
Ausgabe:
Christian Caminada, Das rätoromanische Margrethenlied, im Archiv für schweiz. Volkskunde
1937/38, S. 197—236
Schallplatte: Silvia und Walter Frei, Schweizer Musik aus Mittelalter und Renaissance 11, Luzern 1965
(FGL 254321 )
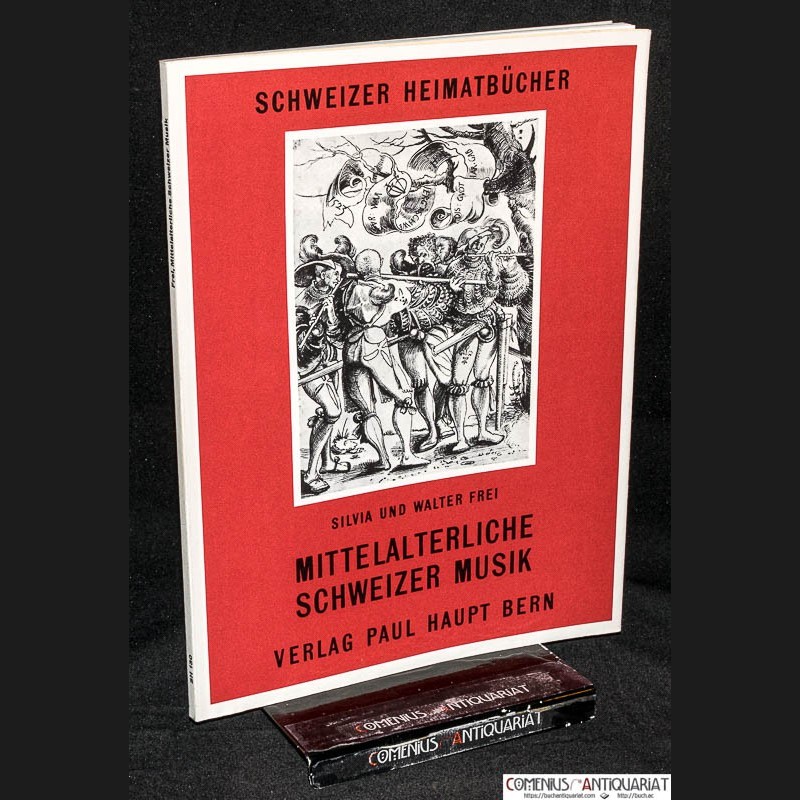
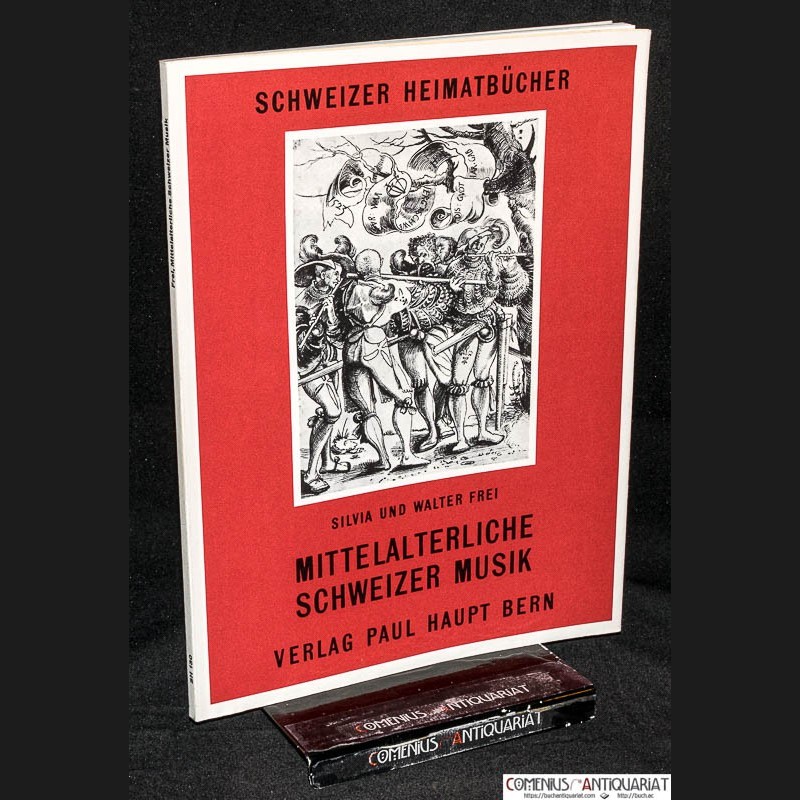
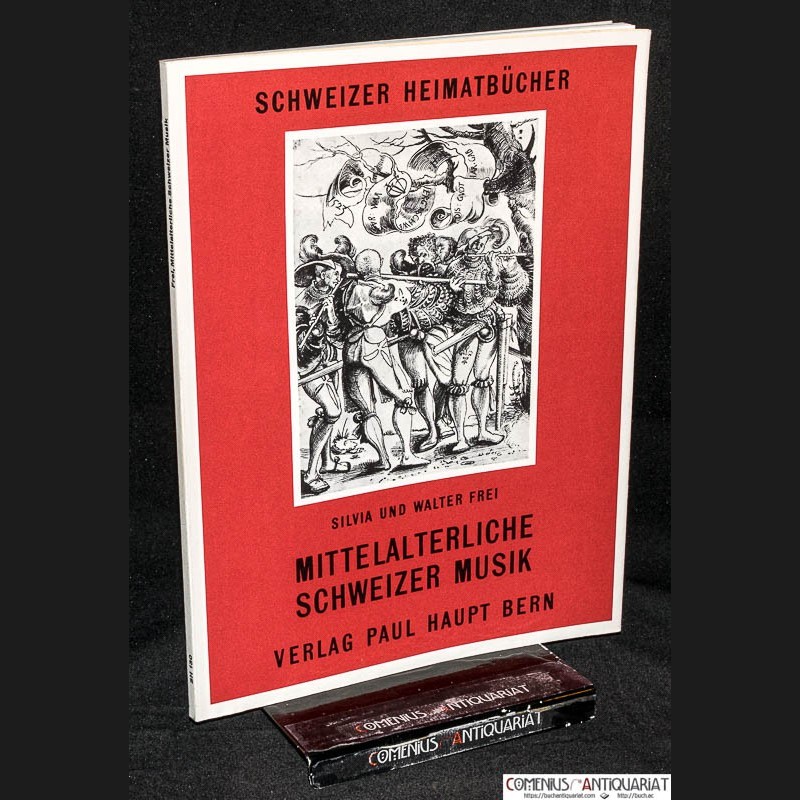
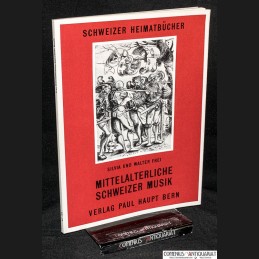
 Datenschutz
Datenschutz
 Versandkosten
Versandkosten
 Google Mail
Google Mail