Buri, Fritz,
Prometheus und Christus. Grösse und Grenzen von Carl Spittelers religiöser Weltanschauung. Bern : Francke, 1945. 282 Seiten. Broschur. Grossoktav. 239 x 164 mm. 476 g
* Etwas gebräunt, Umschlag lichtrandig und schwach fleckig.
Bestell-Nr.159478
Buri |
Carl Spitteler |
Biographien Literatur |
Literaturgeschichte |
Sekundaerliteratur Carl Spitteler |
Christentum |
Theologie
FRITZ BURI
Prometheus und Christus
Grösse und Grenzen von Carl Spittelers religiöser Weltanschauung
282 Seiten Brosch.
A. FRANCKE AG., VERLAG, BERN
Wenn heute Carl Spittelers Persönlichkeit und Werk erneut stark in den Vordergrund treten, so wird man auch eine klärende überschau über sein philosophisch-religiöses Weltbild, wie das vorliegende Buch sie bietet, lebhaft begrüssen.
Spitteler selber hat zwar allen literarischen Analysen mit einem gewissen unwirschen Hohn den Kampf angesagt und philologische Arbeit in zahllosen Parodien und Satiren verspottet. Aber sein eigenes aggressives Temperament, sein ganz auf Persönlichkeitsbewusstsein begründetes Bekenntnis zur «Herrin Seele» als oberster ethischer Instanz, seine ganze Leidenschaft für Widerspruch und Satire überhaupt rufen ganz natürlicherweise immer wieder nach entgegnenden Stimmen. Eine bloss passive Aufnahme des Werkes wäre im Grunde auch gar nicht im Geiste des Dichters. Solange es SpittelerLeser gibt, wird es auch SpittelerDiskussionen geben.
Es liegt denn auch — seit den ersten Kritiken Josef Victor Widmanns — eine reiche SpittelerLiteratur vor. Das neue Buch Dr. Fritz Buris darf man darin in manchem Sinn als zusammenfassendes Werk und als eine (soweit dies möglich ist) endgültige Klärung weltanschaulicher Fragen ansehen. Buri geht von Anfang an auf den Kernpunkt Spittelerscher Dichtung los. In einer gründlichen, die Tiefe suchenden Darstellung legt er das Werden von Spittelers Persönlichkeit und das Wesen seines Geistes dar — vom jungen Theologiestudenten, der sich am starren kirchlichen Dogma wundstösst, bis zum Künder eines eigenen Weltbildes, in dessen Mittelpunkt Prometheus und die «Herrin Seele» stehen. Das erste Auftreten des Namens Prometheus in Aufzeichnungen und Briefen und die leidenschaftliche Auseinandersetzung mit dem christlichen Messias stehen am Anfang der Untersuchung. Die mannigfaltigen Mythen und Symbole in Spittelers Werk, welche 'Weltschöpfung, Dasein, göttliche «Ordnung» und Erlösertum in dichterische Bilder kleiden, werden herausgegriffen und nach Gehalt und Absicht dem christlichen Glauben gegenübergestellt. Wenn die innere Grösse und Gestaltungskraft des Dichters voll anerkannt wird, so tritt anderseits auch die Begrenztheit und der Widerspruch in Spittelers kosmischem Pessimismus zutage. Es ergibt sich das Gesamtbild eines bösen oder kranken obersten Prinzips (Ananke, der Automat, der «kranke Gott») mit der einzigen Erlösungsmöglichkeit durch völlige Austilgung des Lebens. In dieser Negation findet Buri nicht nur einen Widerspruch zu Spittelers eigenem Persönlichkeitskult und zu der «Herrin Seele» (die gleichfalls vernichtet würde), sondern auch grundsätzlich einen einseitigen Pessimismus und eine überschärfte Satire, die der stärkenden und aufbauenden Kraft des christlichen Bekenntnisses ermangeln. Die Epoche Nietzsches mit dem grosswerdenden Herrenmenschengefühl und dem Geiste der Verneinung spricht sich darin aus. Es ist gewiss kein Fehlgriff, wenn dies zeitbedingte Weltbild heute aus christlicher und humanitärer Schau — auch von der Erfahrung des aktuellen Weltgeschehens aus — in seiner begrenzten Bedeutung und seinen Widersprüchen und Übersteigerungen erkannt wird.
Man ist dem Verfasser für seine ernste und verantwortungsbewusste Auseinandersetzung mit Spitteler dankbar. Sie lässt die Pflicht zur Verehrung der rein dichterischen Werte nie aus dem Auge und bekennt sich doch frei zu gegensätzlicher Auffassung, wo sie muss.



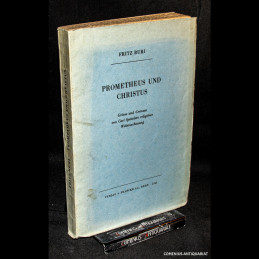
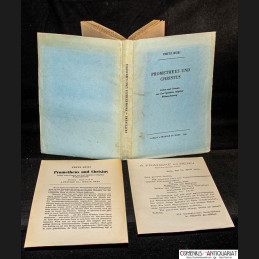
 Datenschutz
Datenschutz
 Versandkosten
Versandkosten
 Google Mail
Google Mail
