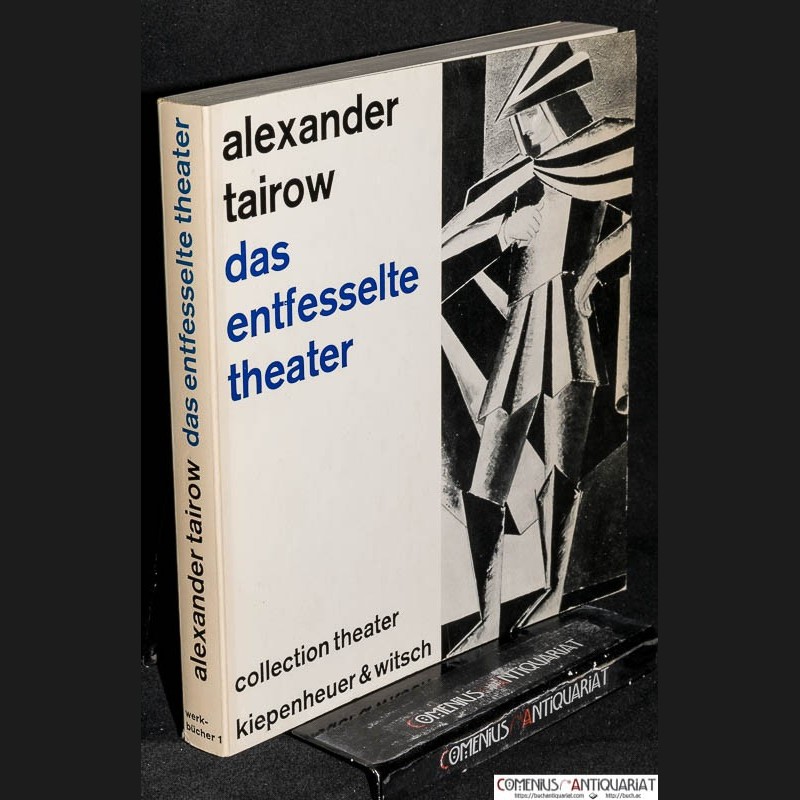Tairow, Alexander,
Das entfesselte Theater. Neuausgabe. Köln, Berlin : Kiepenheuer & Witsch, 1964. 181 Seiten mit Abbildungen. Kartoniert. Kleinoktav. 241 g
* Collection Theater : Werkbücher; 1
Bestell-Nr.154647
Tairow |
Theater |
Tairoff |
Tairov
collection theater werkbücher 1 kiepenheuer & witsch
Der Einfluß der »Aufzeichnungen eines Regisseurs« von Alexander Tairow, 1923 erstmalig unter dem Titel Das entfesselte Theater deutsch erschienen, hier nach der vergriffenen ersten Ausgabe neu aufgelegt, war und ist evident; von Tairow gingen entscheidende Impulse aus, die im deutschen expressionistischen Theater — vor allem bei der Sturm-Bühne — bei Leopold Jessner, Karl Heinz Martin, in Frankreich besonders bei der Copin-und Dullinschule, der »Musique Corporelle« Jean Dastés sichtbar sind.
Der vielleicht mißdeutbare Begriff des »entfesselten« Theaters meint keineswegs ein exzessives, sich austobendes Theaterspielen, sondern an strenge Regeln gebundene, zuchtvolle Form. Tairow sucht (im Unterschied beispielsweise zu Stanislawskij), indem er die Theatralisierung des Theaters, die Autonomie des Theatralischen fordert, sich zu befreien von der »Fessel der Gebundenheit an literarische Texte«, er kündigt den bloßen Dienst an der Dichtung auf und erstrebt eine konstruktive, exakte, eigenständige Bühnengestaltung. In der Besinnung auf die Erneuerung der mimischen Kunst und zugleich der alten komödiantischen Theaterformen Europas und des Orients treffen sich die Reformbestrebungen Tairows mit denen seiner berühmten Zeitgenossen Gordon Craig und V. Meyerhold — wenn auch Tairow in den »Aufzeichnungen« gegen eben diese Zeitgenossen gelegentlich polemisiert.
1914 eröffnete Tairow in Moskau sein »Kammertheater«, dessen Stil sich bewußt in scharfen Kontrast zur Außenwelt — Kriegs- und Revolutionswirren — stellt, eine verfeinerte, brillante, ästhetische Bühnenwelt schafft. Tairow veranstaltet ein Festival der Künste auf der Bühne und manifestiert eine von der Realität unabhängige Theaterkunst, die nur ihren eigenen Gesetzen gehorcht. Sie bedeutet den Bruch mit der Alltäglichkeit, Erlösung der Welt durch Phantasie. Die offizielle Kritik blieb dann auch nicht aus. Zwar sucht Tairow sich dem dogmatischen Realismus des herrschenden Regimes zu nähern, 1949 aber muß das »Kammertheater« trotz aller Kompromisse schließen.
Die »Aufzeichnungen« sind nicht nur nüchternes Dokument, sie strahlen auch heute noch Enthusiasmus und Spontaneität des nicht theoretisierenden, besessenen Regisseurs aus, der das Theater liebt.
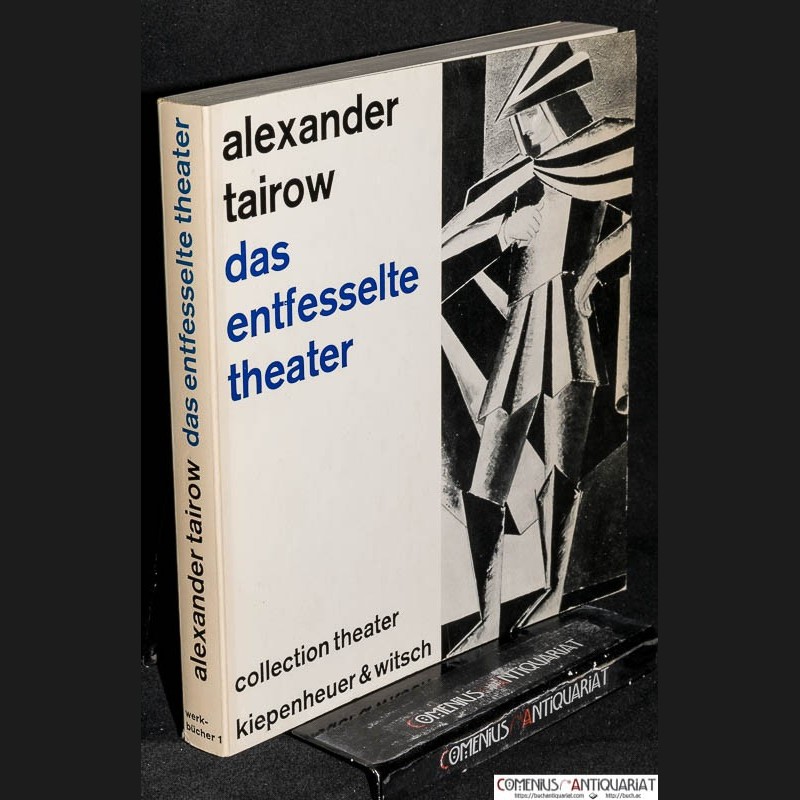
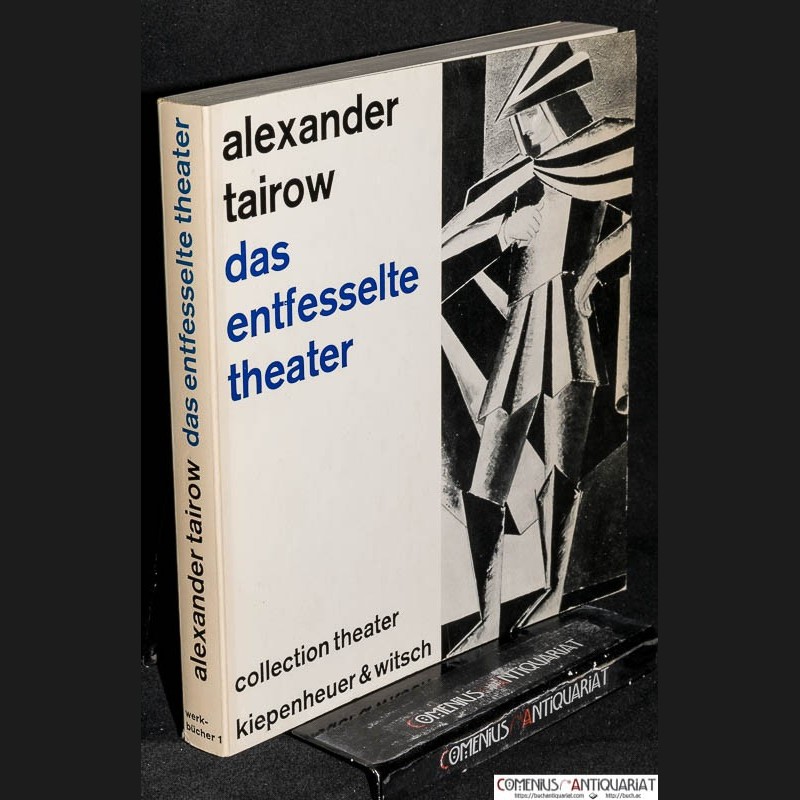
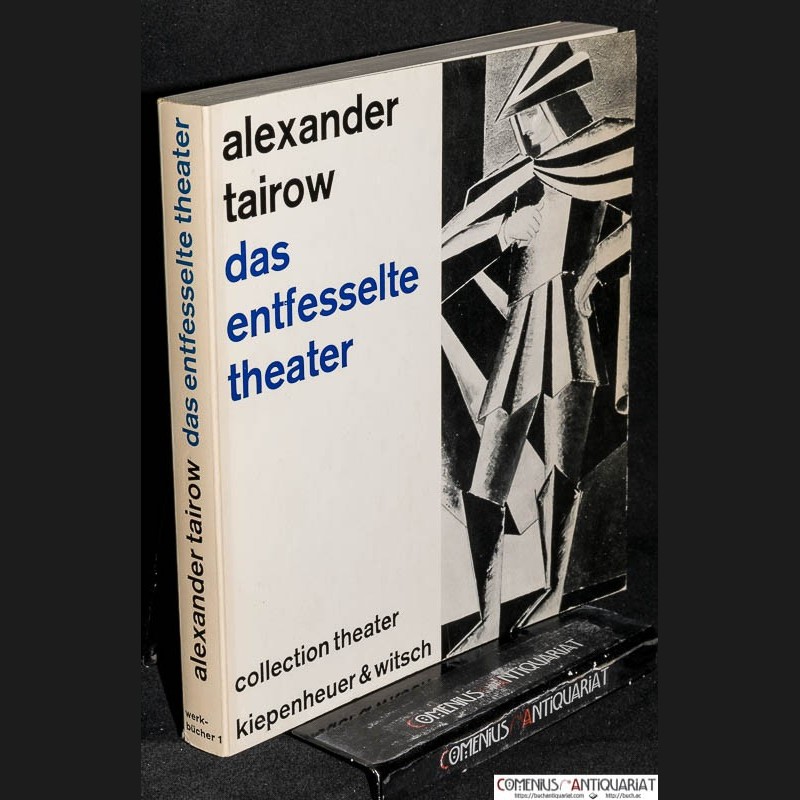

 Datenschutz
Datenschutz
 Versandkosten
Versandkosten
 Google Mail
Google Mail