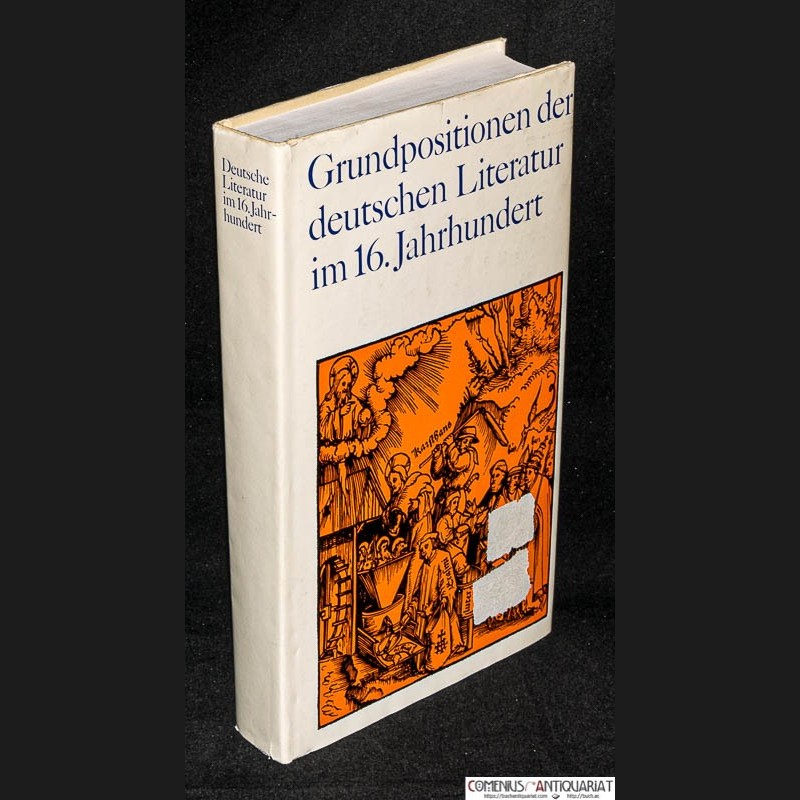Spriewald, Ingeborg u.a.,
Grundpositionen der deutschen Literatur im 16. Jahrhundert. 2. Auflage. Berlin, Weimar : Aufbau-Verlag, 1976. 492 Seiten mit Register. Pappband (gebunden) mit Schutzumschlag. 494 g
* Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Literaturgeschichte. - Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren und Beschädigungen vermutlich von entfernten Preisetiketten.
Bestell-Nr.155867
Deutsche Literatur |
Germanistik |
Literaturgeschichte |
Sechzehntes Jahrhundert
Inhalt
Einführung 5
Zur Funktion und Wirkung der volkssprachlichen Literatur. Von Hildegard Schnabel 21 Aufgabenstellung und Stand der Forschung 21 Die hochmittelalterliche Situation 25 Die höfische Dichtung: ihre Träger 25 — Wirkungsabsichten 26 — Verhältnis zum Publikum 28 — Der späthöfische Dichter und sein Publikum 29 — Die geistliche Literatur: Wirkungsabsichten 33 — Kampf gegen die weltliche Dichtung als „schöne Lüge" 35 — Die mündlich tradierte Volksdichtung 38 — Ihre Träger und ihr Publikum 39 — Grundzüge der Funktions- und Wirkungszusammenhänge der hochmittelalterlichen Literatur 41 — Die Leistung dieser Literatur 44
Wandlungsprozesse am Beginn des Ilbergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus Sozialökonomische Grundlagen der europäischen Renaissance 46 — Situation in Deutschland 48 — Vergleich mit anderen europäischen Ländern 51 — Die einfache Warenproduktion als kulturgünstiges Moment 52 — Der Handwerkerdichter 57 — Weiterwirken kollektiver Lebens- und Bewußtseinsformen 60 — Auswirkung auf das künstlerische Schaffen 64 — Fastnachtspiel und Volkslied als Ausdruck kultureller Gemeinschaftsbetätigung 66 — Volkstümlichkeit 69 — Neubewertung der Arbeit 70 — Bürgerliches Berufs- und Leistungsdenken 72 — Didaktik 76 — Bedeutungtrhucks — Verhältnitetclerspätinitigatterlidien Literatur t bd 41 tsorck_ n
45
489
Funktions- und Wirkungszusammenhänge während der frühbürgerlichen Revolution 84 Neuansätze kritischoppositioneller Literatur im Vorfeld der Revolution 84 — Die Predigt als Kritik von unten 86 1— Die Kritik der Humanisten 89 — Funktion der Literatur bei Luther 91 — Flugblatt und Flugschrift 92 — Literatur als Anleitung zum Handeln 93 — Enthüllungsfunktion 97 — Kriterien der Volkstümlichkeit 97 — Bedeutung der Volkssprache 98 — Programmatische Funktion 99 — Literatur als revolutionäres Kampfinstrument 100 — Rezeptionsmöglichkeiten der unteren Volksschichten 101 —Wirkungsradius der revolutionären Literatur 105 Grundzüge des Menschenbildes. Von Werner Lenk 107 Zur Problemstellung 107 Menschenbild und Humanismus heute 107 — Menschenbild und Geschichtsprozeß 108 — Menschenbild im 15116. Jahrhundert 111
Der Ackermann und das Menschenleben 114 Zur Ackermannforschung 114 — Todesproblem im Spätmittelalter 115 — Vom persönlichen Erleben zur Frage nach Gottes Ordnung 11.6 — Verteidigung der Würde des Menschen 123 — Antithetische Form 128 — Der Tod als Naturgesetz und als Bezugspunkt christlicher Ideologie 131 - Hussitische Akzente 134 — Ein Menschentyp wider die christliche Ordnung 137 — Tod und Fortuna als Problem der Renaissancephilosophie 145 „Reinke de Vos": Die Demaskierung der Feudalität und die Chancen des Listigen 149 Die europäische Tradition 149 — Gerichtstag über die Feudalgesellschaft 150 — Beziehung zum Schwank 158 —Soziale Profilierung Reinekes 161 — Die Moral der Unterdrückten 163 — List und gesellschaftliche Bewußtheit 167 — Die Frage nach dem realen Humanismus 171 — Reineke, der Selbsthelfer 172
Salomon und Markoli: Die dichterische Gestaltung gegensätzlicher Existenzweisen des Menschen in der Klassengesellschaft Klein- und Großformen volkstümlicher Dichtung 175 —
490
175
Wandlungen der Markolfgestalt 177 — Volkstümliches Sprichwort 181 — Weltanschauliche Antithetik als sozialer Gegensatz 183 — Naiver Materialismus und Renaissanceidealismus 193 Die gesellschaftliche Rangerhöhung und literarische Modellierung des „gemeinen Mannes" 198 Der Stadtbürger und die Arbeit 200 — Hans Rosenplüts Lob der Arbeit 201 — Lob des bürgerlichen Gemeinwesens 206 — Der „gemeine Mann" und die Narrenfigur 210 — Rangerhöhung des Bauern 214 — Die Reformation und das Bild des „gemeinen Mannes" 218 — Karsthans 222 —Der „gemeine Mann" im Reformationsdialog 224 Thomas Müntzer: Von der Erneuerung der Gesellschaft und der Herrschaft des Volkes 231 Zwei Fraktionen der frühbürgerlichen Revolution 231 — Die plebejischbäuerliche Fraktion und Thomas Müntzer 232 — Die „Verneuung" des Menschen, die „Auserwählten" 234 — Die religiöse „Verkleidung" 240 — Verbindung von revolutionärer Theorie und Aufstandsbewegung 243 —Die Lehre von der revolutionären Gewalt 247
Wirklichkeitsgestaltung im Neubeginn der Prosaerzählung. Von Ingeborg Spriewatd 250 Zum Gegenstand und zur Problemstellung 251 Engels über die Volksbücher 251 — Umkreis der Erzählprosa um 1560, die Ritterhistorien 252 — Aufnahme der Renaissancenovelle 258 — Jörg Wickrams Prosaschaffen 259 Wirklichkeitserkenntnis — Erzählerstandpunkt — Erzählperspektive 261 Künstlerische Methode und Realismus 261 — Erzählerstandpunkt und Erzählperspektive zwischen Epos und; Roman 265 — Ansätze zum Hervortreten des individuellen Erzählers 268 — Standpunktgewinnung durch das Freundschaftsmotiv 274 — Gestaltung des bürgerlichen Menschentyps 276
Belehrung und Bewußtseinsbildung 281. Art der Einflußnahme 281 — Ideologiebetontheit 283 — Ratgeberverhältnis und didaktisches Beispiel 284 — Ansätze zur Entwicklungsbetonung der Helden 289
491
Ambivalenz der Erzählgestaltung 292 Rahmenstruktur und Zyklenbildung 293 — Eingliedriger Aufbau 295 — Mehrsträngige Handlung bei Wickram 296 — Nähe mündlicher Erzählweise 297 — Brief, Monolog und Dialog als Elemente der Leseliteratur 299 — Volkstümlichsprechnahe Erzählweise und rhetorische Stilisierung 303 — Vorstöße bei der Erfassung des emotionalen Bereichs 309
Die gewonnenen Positionen 312 Der Gewinn an Realismus in der Renaissancenovelle 312 — Mischung des Novellistischen mit älteren Erzählformen 316 — Eigenwert der frühen deutschen Prosaerzählung 322
Zum Dichtungsbegriff des deutschen Humanismus. Von Heinz Entner 330 Der Humanismus und das dichtungstheoretische Erbe der Antike 330 Neulateinische und volkssprachliche Dichtung 330 — Gesellschaftliche Basis der humanistischen Bewegung 335 — Die Interpretation von Aristoteles' „Poetik" 338 — Horaz' „Ars poetica" 343 — Celtis und Opitz als Markierungspunkte der deutschen Renaissancepoetik 347
Die humanistische Poetik und ihre theoretische Position Dichtung als Wissenschaft und schöpferischer Akt: Celtis 351 — Darstellung durch Wortgestalt und Rhythmus 355 — Wissenschaft und Literatur im 16. Jahrhundert 359 — Der Dichter als Dolmetsch der Schulweisheit: Corvinus 361 — Humanistischer Klassizismus: Bebel 365 — Vadian über volkssprachliche Dichtung 368 — Dichtung als Beschreibung: „Ut pictura poesis" 370 — Dichtung als Allegorie, das Fiktionsproblem 376 — Wahrscheinlichkeit contra Möglichkeit: Pontanus 379 — Neuplatonisches: Ingenium und numerus 383
351
Die humanistische Verteidigung der Poesie 388 Kirchlicher Rigorismus: Murner 388 — Verteidigung des Humanismus in der nachrevolutionären Periode 391 —Hinwendung zur Prosa und Volkssprache: Caselius 393 —Das Lied als Ansatzpunkt der neuen Lyrik 395,
492
Anhang
Anmerkungen 401 Register 480 Personen 480 Anonyma 487
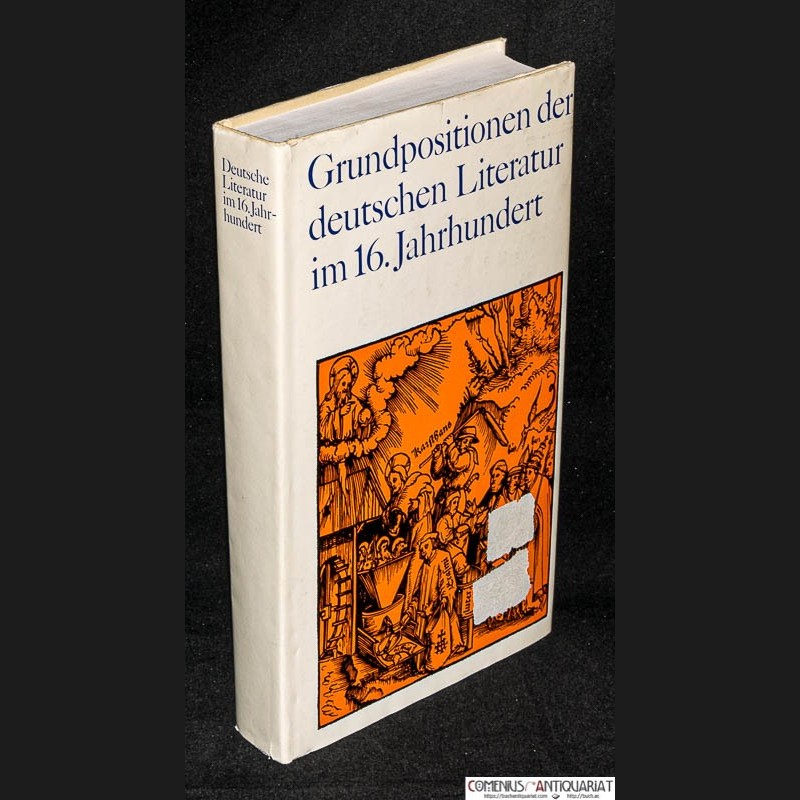
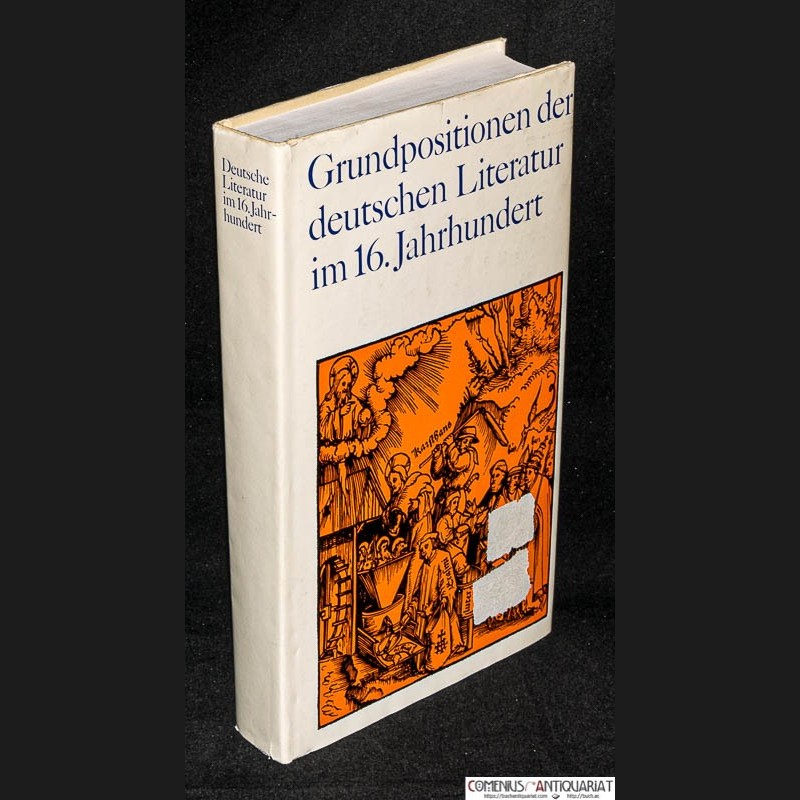
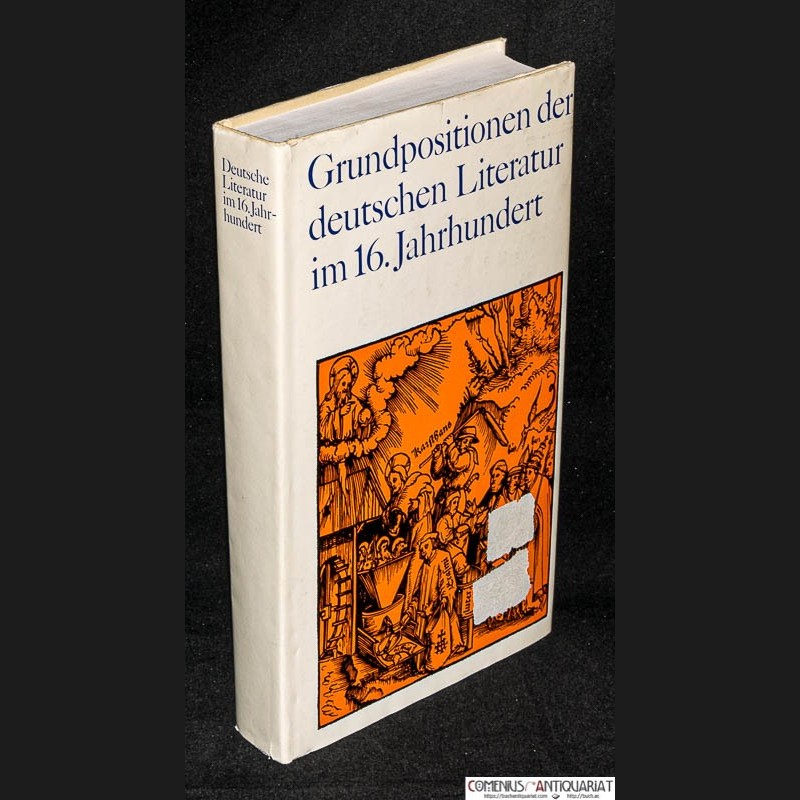
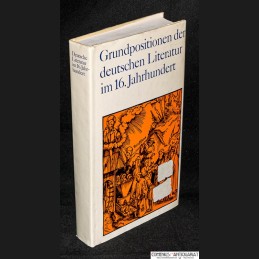
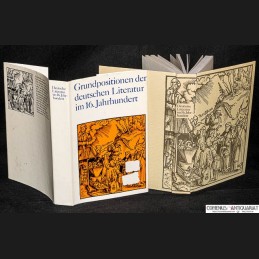
 Datenschutz
Datenschutz
 Versandkosten
Versandkosten
 Google Mail
Google Mail