Steinweg, Karl.
Goethes Seelendramen und ihre französischen Vorlagen. Ein Beitrag zur Erklärung der Iphigenie und des Tasso sowie zur Geschichte des deutschen und des französischen Dramas. Halle: Niemeyer, 1912. XI, 258 Seiten. Leinen mit Farbkopfschnitt. 224 x 148 mm. 490 g
* Zur Entwicklungsgeschichte der Tragödie; 3. - Gebräunt.
Bestell-Nr.159169
Steinweg |
Germanistik |
Theater |
Literaturwissenschaft allgemein |
Biographien Literatur |
Literaturgeschichte |
Sekundaerliteratur Goethe |
Goethe
Inhalt.
I. Teil. Goethes Seelendramen: Iphigenie auf Tauris,
Torquato Tasso. S. 1—146.
1. Iphigenie auf Tauris. S. 3—-59.
Die Begebenheit S. 5. Das äussere Drama S. 8. Das
psychologische Drama S. 17. Die Charaktere S. 27—44.
Iphigenie S. 27. Orest und seine Entsühnung S 32. Arkas und
Pylades S. 37. Thoas S. 41. Die Technik S. 45—59. Die
äussere Anlage S. 45. Die dramatische Perspektive S. 48. Technik
der Charakterkomposition S. 55. Kontraste und ihre Harmoni-
sierung S. 57.
2. Torquato Tasso. S. 61—140.
Die Begebenheit S. 63. Das äussere Drama S. 67—72.
Das Duellstück S. 67. Die Intrige S. 68. Das innere, psycho-
logische Drama S. 72—84. Die Tragödie der Prinzessin
S. 84. Verzeichnungen S. 85—92. Verzeichnung der Rolle An-
tonios S. 88. Verzeichnung der Rolle Leonorens S. 90. Begriff
der eigentlichen Handlung S. 93. Die Charaktere S. 101
bis 122. Leonore S. 101. Die Prinzessin S. 105. Antonio S. 109.
Tasso S. 113. Überblick über die Charaktere S. 118. Die Technik
S. 123—134. Die äussere Anlage S. 123. Der Rhythmus S. 125.
Bestrebungen nach Ausgleich und Harmonisierung S. 126. Bin-
dung S. 127. Sinn und Summe des Ganzen S. 135.
9. Vergleich zwischen „Iphigenie" und „Tasso S. 141—146.
II. Teil. Die französischen Vorlagen. S. 147—237.
A. 1. Die Entwicklung des Seelendramas von Corneille zu Racine
und Goethe mit Bezug auf Wagner und die moderne Kunst.
s. 149—188.
Die Anfänge, des Seelendramas bei Corneille S. 151.
Cid S. 151. Horace S. 152. Cinna S. 153. Polyeuct S. 155.
Racine, der Erfinder des Seelendramas S. 158. Andro-
mache S. 158. Berenice S. 163. Bajazet S. 165. Mithridates S.
170, Iphigenie S. 173. 174. Mystik in Goethes
Tasso S. 175} bei den englischen Präraffaöliten S. 176, bei Wagner
s. 177.
2. Charakteristik des Seelendramas. Seine Erhöhung durch
Goethe und seine Vollendung durch Wagner und die moderne
Kunst. S. 178—188
Nähere Begriffsbestimmung: 1. Das Seelendrama
als Qualdrama mit schliesslichem Verzicht Unter
Schmerzen S. 179. Erhebung dieses Motivs durch Wagner in
den Meistersingern S. 181. Behandlung in der modernen Kunst
durch Rodin S. 183. 2. Das Seelendrama als Tragödie der
Frau S. 184. Goethes Hinwendung von der irdischen zur himm-
lischen Liebe S. 184. Versuch, die Psyche des Mannes zu schildern
S. 185. 3. Das Seelendrama in der Handlung
ausgehend, den Helden seelisch herabzustimmen: Aus-
schaltung der Intrige S. 185. Grundform des französischen
Seelendramas S. 186.
B. Technik des französischen Seelendramas mit Bezug
auf Goethes Technik in der Iphigenie und im Tasso.
s. 189—237.
1. Das iussere, Architektonische und Plastische. S. 191—204.
Die Grundlagen S. 191. Der Aufbau. Das Prinzip
der Gruppe S. 195. Corneilles Cinna S, 196. La Fontaine S. 197.
Komposition der Fabel vom Wolf und vom Hunde nach dem
Prinzip der Gruppe S, 198. Gruppenkomposition in Goethes Iphi-
genie und im Tasso S. 200, in Wagners Tristan S. 2011 bei Fer-
dinand Hodler S. 202. Statuarische Auffassung der Per-
sonen S. 202.
2. Das Innere und Einzelne. S. 205—M.
Monolog und Botenbericht S. 205. Corneilles Cid S. 205.
Cinna S. 206. Racines Andromache S. 206. Berenice S. 207.
Mithridates S. 207. Goethes Tasso S. 209. Der zerschnittene
Botenbericht als Mittel zur Qualsteigerung S, 210. Die
Rolle der Vertrauten S. 213. Gegensätze S. 213. Wieder-
holungen und Unterbrechungen: Der Rhythmus des Ganzen
S. 216—225. Wiederholungen S. 216. Das Ornament S. 216.
Wiederholungen in der Musik und in den redenden Künsten
S, 217. Wiederholung von Lauten. La Fontaine S. 218. Goethe
S. 219. Corneille S. 220. Besondere Gründe für Wiederholungen.
Aus architektonischem Empfinden S. 221. Gotisches im Tasso
S. 221. Streben nach Einheit in der modernen Kunst S. 223.
flüsse anderer Kunstgebiete auf das Seelendrama. Millets Ähren-
leserinnen S. 223. Unterbrechungen S. 224, Stilwandlungen S. 225.
Schönheitslinie Winckelmanns S. 227. Mechanik der äusseren
Umstände. Lustspielartiges S, 230. Katastrophe und
Perspektive über das Stück hinaus S. 234.
III. Teil. Erklärung der Beziehungen des deutschen zum
französischen Seelendrama. Forderungen für die Schule.
s. 239—258.
Das Übersehen des Zusammenhanges des deutschen
mit dem französischen Seelendrama S. 241—246. Einfluss
Lessings S. 243. Schillers, Goethes und Wagners Urteil über
Corneille und Racine S. 245. Erklärung der Abhängigkeit
des deutschen vom französischen Seelendrama S. 247
bis 258. Zeit und allgemeine Umstände S. 247. Besondere Über-
einstimmung zwischen Racine und Goethe S. 249. Nationales
S. 257. Lektüre von Goethes Seelendramen auf der Schule im
Zusammenhang mit Corneille und Racine S. 258.




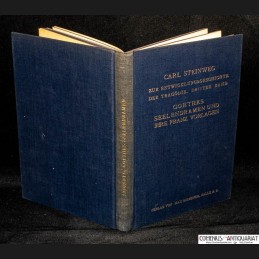
 Datenschutz
Datenschutz
 Versandkosten
Versandkosten
 Google Mail
Google Mail
