Giedion, Sigfried,
Die Herrschaft der Mechanisierung. Ein Beitrag zur anonymen Geschichte. Frankfurt am Main : Europäische Verlagsanstalt, 1982. 843 Seiten mit Abbildungen und Register. Leinen mit Schutzumschlag. Grossoktav. 240 x 175 mm. 1710 g
* Europäische Bibliothek; 8. - Mit einem Nachwort von Stanislaus von Moos. - Gebräunt.
DIESER TITEL IST VERKAUFT UND LEIDER NICHT MEHR BESTELLBAR
THIS TITLE IS SOLD AND NO LONGER AVAILABLE | ISBN: 978-3-434-00711-1
Giedion |
Soziologie |
Technik |
Mechanisierung |
Architektur |
Technikgeschichte |
Industrie |
Kulturkritik
Sigfried Giedion ist als Autor des Standardwerkes über die Entwicklung und das Selbstverständnis der modernen Architektur (»Raum, Zeit, Architektur«) weltweit bekannt geworden. Die dort vorgelegten Analysen werden in »Die Herrschaft der Mechanisierung« fortgeführt, erweitert und vertieft zu einer Auseinandersetzung mit den Lebensfragen der modernen Zivilisation. Als dieses Buch 1948 in den Vereinigten Staaten unter dem Titel »Mechanization Takes Command« zuerst erschien, gab es weder Vorarbeiten noch vergleichbare Versuche einer kritischen Technikgeschichte. Die deutsche Ausgabe erscheint nun in einem Moment, wo sich ein intensives Interesse an den Fragen bemerkbar macht, die Giedion als Pionier zuerst stellte und für deren Beantwortung er immer noch die umfassendste Orientierung bietet.
Giedion unternimmt hier den bis heute an Materialfülle und Perspektivenreichtum nicht überbotenen Versuch, die Verwandlung unserer Alltagsumgebung und unseres Verhaltens durch die Mechanisierung detailliert zu beschreiben. Behandelt werden nicht nur die industriellen Fertigungstechniken und ihr Übergreifen auf traditionelle Produktionssphären wie das Handwerk und die Landwirtschaft, sondern auch die Folgen für den Umgang mit organischer Substanz (Fleisch, Brot) sowie, weiter ausgreifend, die Geschichte des Komforts, die Mechanisierung der Hausarbeit, der Küche, des Bades und der körperlichen Regeneration überhaupt.
Es geht dabei um den Nachweis, daß sich in den Gegenständen unserer Alltagsumgebung Gewalten akkumulieren, durch die die Lebensgrundlagen des Menschen tiefgreifender verändert worden sind als jemals zuvor. Es ist Giedions Verdienst, diese anthropologische Dimension des Fortschritts nicht nur kulturkritisch, sondern in genauer historischer Analyse geltend gemacht zu haben.
Einen besonderen Reiz dieser Untersuchung macht die Fülle des dokumentarischen Materials aus, das in einem fortlaufenden, den Text begleitenden und selbständig lesbaren Bildteil ausgebreitet wird. Die Zeugnisse technischen Erfindungsgeistes deutet Giedion dabei mit derselben Intensität, mit der man Kunstwerke deutet, als Dokumente der »anonymen Geschichte« unserer Epoche und als Ausdruck ihres Kollektivbewußtseins. In ähnlicher Weise wie in den Collageromanen von Max Ernst, die Giedion als eine künstlerische Entsprechung seines eigenen Vorhabens verstand, wird in diesem Bildteil etwas von der Unheimlichkeit jenes 19. Jahrhunderts sieht- das den Traum der Mechanisierung träumte.
Der Autor: Sigfried Giedion (1888-1968) war in Wien zum Ingenieur ausgebildet worden, ehe er sich dem Studium der Kunstgeschichte zuwandte, das er in München bei Heinrich Wölfflin mit einer Arbeit über spätbarocken und romantischen Klassizismus abschloß. Für seinen weiteren Weg entscheidend wurden die Bauhauswoche 1923 in Weimar und die Begegnung mit Le Corbusier 1925 in Paris. Giedion war 1928 Mitbegründer der Internationalen Kongresse für Neues Bauen (CIAM), deren Generalsekretär er 25 Jahre lang blieb. Seit 1938 lehrte er an der Harvard University und später auch alternierend an der ETH Zürich. Veröffentlichungen u. a.: Spätbarocker und romantischer Klassizismus (1922), Bauen in Frankreich (1928), Befreites Wohnen (1929), Space, Time and Architecture (1941, dt. 1965), The Eternal Present: The Beginnings of Art (1962, dt. 1964), The Eternal Present: The Beginnings of Architecture (1964, dt 1965), Architektur und das Phänomen des Wandels (1970).
INHALT
Vorwort 13
TEIL I
ANONYME GESCHICHTE
Anonyme Geschichte 19
Übersicht 21
Typologische Betrachtungsweise 28
Daten 29
TEIL II
QUELLEN DER MECHANISIERUNG
Bewegung 33
Bewegung: Die Einstellung der Antike und des Mittelalters 33
Die erste Darstellung der Bewegung im 14. Jahrhundert 35
Das neunzehnte Jahrhundert und das Einfangen der Bewegung 37
Sichtbarmachung organischer Bewegung in graphischer Form 37
Sichtbarmachung der Bewegung im Raum 40
Erforschung der Bewegung 44
Der Fortschrittsglaube 50
Auffassungen der Mechanisierung 51
Die Erfindung und das Wunderbare 52
Das Wunderbare und das Nützliche 55
Mechanisierung der Produktion 57
Einfaches und kompliziertes Handwerk 58
Die gotischen Wurzeln des hochentwickelten Handwerks 59
Profil der Jahrzehnte 61
Die sechziger Jahre 61
Die Zeit der Vollmechanisierung, 1918-1939 62
TEIL III
MITTEL DER MECHANISIERUNG
Die Hand 69
Standardisierung und Auswechselbarkeit 71
Mechanisierung eines komplizierten Handwerks 74
Das Handwerk des Schlossers 74
Vom Handwerk zur mechanischen Produktion 76
Das frühe Stadium: Geldschrank und aufsperrsichere Tresorschlösser 78
Die Verbesserung des Tresorschlosses 80
Linus Yales Tresorschlösser 83
Die Erfindung von Linus Yale 86
Linus Yales Konstruktionen 87
Archetypen 93
Das Schloß mit Holzschlüssel 97
Das Schloß mit Holzschlüssel in Pennsylvanien 100
Fließband und wissenschaftliche Betriebsführung 101
Die kontinuierliche Bandproduktion im achtzehnten Jahrhundert 103
Oliver Evans 103
Die Anfänge des Fließbandes 111
1804 - 1833 - 1839 - Die sechziger Jahre - 1869
Die Entstehung der wissenschaftlichen Betriebsführung 120
Um 1900 120
Der Betrieb als Organismus 124
Raum-Zeit-Studien in der wissenschaftlichen Betriebsführung 125
Wissenschaftliche Betriebsführung und zeitgenössische Kunst 126
Präzise Bewegungsaufzeichnung, um 1912 127
Bewegung in aufeinanderfolgenden Phasen, um 1912 130
Bewegung als Form für sich, um 1920 133
Vorläufer, Fortführer? 138
Charles Babbage 138
Charles Bedaux 139
Das Fließband im zwanzigsten Jahrhundert 140
1913-1914 140
Das automatische Fließband, um 1920 143
Menschliche Auswirkungen des Fließbandes 146
TEIL IV
MECHANISIERUNG UND ORGANISCHE SUBSTANZ
Die Mechanisierung und der Boden: Landwirtschaft 157
Der Bauer im Strukturwandel der Landwirtschaft 157
Die Wiederentdeckung der Natur im achtzehnten Jahrhundert 161
Die Naturwissenschaften 162
Der Boden 162
Die Landwirtschaft als ursprüngliche Berufung des Menschen 164
Die neue Landwirtschaft in England 165
Der Mittlere Westen und die Mechanisierung der Landwirtschaft 169
Die Prärie 169
Entwicklungstempo und soziale Folgen 171
Instrumente der Mechanisierung 174
Die Neuformung der Werkzeuge in Amerika 174
Die Mechanisierung des Mähens 175
Die Landwirtschaft während der Vollmechanisierung 189
Der Traktor 189
Kombination von Arbeitsvorgängen 190
Die Farm als Heimstatt und Fabrikbetrieb 192
Menschliche Auswirkungen 195
Mechanisierung und organische Substanz: Brot 197
Mechanisierung des Knetens 197
Mechanisierung des Backens 200
Der Backofen der handwerklichen Periode 200
Der Einfluß der Technik: der indirekt geheizte Ofen 201
Backofen und endloses Band 203
Mechanisierung der Brotherstellung 207
Brot und Gas 209
Der menschliche Aspekt: Brot und Mechanisierung 216
Das Mehl in der Massenproduktion 216
Vollmechanisierung: Brot am Fließband 220
Die veränderte Struktur des mechanisch hergestellten Brotes 225
Die Mechanisierung verändert den Publikumsgeschmack 229
Sylvester Graham (1794-1851) und die Entwertung des Brotes 230
Mechanisierung und Tod: Fleisch 238
Zentralisierung und Handwerk 238
Paris, das Schlachthaus von La Villette (1863-1867) 238
La Villette und die Union Stockyards von Chicago (1864) 241
Die Mechanisierung der Fleischindustrie in Amerika 242
Die Anfänge der Mechanisierung: Cincinnati (1830-1860) 244
Die Ausdehnung der Mechanisierung: Chicago (1860-1885) 247
Packer und Packerindustrie 252
Einzeloperationen in der mechanisierten Fleischverarbeitung 257
Mechanisierung und organische Substanz 259
Die Mechanisierung des Todes 270
Mechanisierung und Wachstum 278
Samen 279
Das Ei 281
Mechanische Befruchtung 283
TEIL V
MECHANISIERUNG UND MENSCHLICHE UMGEBUNG
Mittelalterlicher Komfort 291
Mittelalter und Mechanisierung 291
Der Wandel in der Auffassung des Komforts 292
Die Körperhaltung im Mittelalter 295
Hochgericht in Frankreich, 1458 298
Karnevalsszene in einer holländischen Küche, um 1475 298
Oberrheinische Wohnstube, um 1450 300
Schweizer Schulzimmer, 1516 300
Königliche Tafel, um 1460 301
Das Erscheinen des Stuhls, um 1490 302
Die nomadischen Möbel des Mittelalters 304
Die Truhe als Universalmöbel 307
Die Schublade 310
Gotisches Möbelbauen 312
Die Beweglichkeit des gotischen Möbels 315
Die drehbare Achse 316
Das Scharnier 325
Der zerlegbare Tisch 326
Die Schaffung der intimen Umgebung: Differenzierung der Möbeltypen 330
Stühle in romanischer Zeit 331
Flandern und die Schaffung der intimen Umgebung 332
Mittelalterlicher Komfort: Komfort des Raumes 334
Komfort im achtzehnten Jahrhundert 340
Frankreich: Rokoko und Natur 340
Die Formung von Behältern 340
Die Schaffung des Sitzkomforts 343
England: Form und Mechanisierung 354
Der Gentleman bestimmt den Stil 358
Das Bibliothekszimmer 359
Das Eßzimmer 360
Wiederentdeckung der Reinlichkeit 361
Beweglichkeit 361
Das neunzehnte Jahrhundert: Mechanisierung und herrschender Geschmack 366
Gegen den Mißbrauch der Mechanisierung: Die englischen
Was geschieht mit der menschlichen Umgebung im
Die Anfänge des herrschenden Geschmacks: Der Empirestil 366
Napoleon und die Entwertung der Symbole 366
Die Schöpfer des Empirestils: Percier und Fontaine 369
Was geschieht im Empirestil? 377
Mechanisierung der Ausschmückung 381
Ersatzstoffe und Imitation des Handwerks, 1820-1850 383
Reformer um 1850 386
Die Herrschaft des Tapezierers 402
Der Tapezierer 402
Gegenströmungen: Ingenieur und Reformer 404
Die Möbel des Tapezierers 405
neunzehnten Jahrhundert? 426
Die konstituierenden Möbel des neunzehnten Jahrhunderts 429
Patentmöbel und herrschender Geschmack 429
Möbel und Mechanisierung 432
Die Jahrzehnte der Patentmöbel, 1850-1890 433
Ein Zugang zum Möbel des neunzehnten Jahrhunderts 434
Das Möbel des Mittelstands 435
Körperhaltung im neunzehnten Jahrhundert 436
Beweglichkeit 438
Die Haltung, physiologisch betrachtet 440
Sitzen 441
Liegen 449
Verwandelbarkeit 465
Mechanische Metamorphose 465
Verwandelbarkeit der Flächen 468
Kombination und Mimikry 476
Eisenbahn und Patentmöbel 481
Reisekomfort 482
Personenwagen und verwandelbarer Sitz 486
Der Schlafwagen: Verwandelbarer Sitz und aufklappbares Bett 491
George M. Pullmann und der Luxus des Reisens 494
Vorstufen des Schlafwagens (1836-1865) 500
Pullmanns Expansion 504
Schlafwagen in Europa 505
Ausbau des Reisekomforts: Speise- und Salonwagen 506
Rückblick 510
Die nomadischen Möbel des neunzehnten Jahrhunderts 511
Das leichte Feldmöbel 511
Die Hängematte 513
Die Hängematte und Alexander Calder 518
Die Bedeutung der konstituierenden Möbel 520
Einwände gegen Mechanismen im Möbel 523
Patentmöbel und die Bewegung um 1920 523
Die konstituierenden Möbel des zwanzigsten Jahrhunderts 525
Die Möbel und ihre Gestalter 525
Die »Craftsman«-Bewegung 525
Der Architekt als Typengestalter 526
Die Entstehung der Typen 528
G. Rietveld, der Vorläufer 528
Die Typenbildung des Stahlrohrstuhls 531
Der freitragende Stahlrohrstuhl 536
Der bewegliche Stahlrohrstuhl 542
Der freitragende Holzstuhl 549
Ausbreitung 552
TEIL VI
DIE MECHANISIERUNG DES HAUSHALTS
Die Mechanisierung des Haushalts 557
Frauenbewegung und Rationalisierung des Haushalts 557
Die Stellung der Frau 557
Frauenschulung und Frauenfrage 558
Die Dienstbotenfrage 560
Organisation des Arbeitsvorganges 563
Organisierung des Arbeitsvorganges, 1869 563
Organisierung des Arbeitsvorganges, nach 1910 566
Organisierung des Arbeitsvorganges in Europa, um 1927 567
Die Mechanisierung der Feuerstelle 572
Der Herd: Konzentration der Wärmequelle 572
Der gußeiserne Herd 573
Die Zeit des Gasherdes, 1880-1930 583
Elektrischer Strom als Heizquelle 588
Mechanischer Komfort im Haushalt 595
Mechanisierung der kleineren Haushaltsgeräte, um 1860 600
Der elektrische Kleinmotor 604
Die Mechanisierung des Reinigens: Waschen 608
Nachahmung der Hand 608
Die beiden Wege der Mechanisierung 610
Zögernde Einführung 613
Vol.lständige Mechanisierung des häuslichen Waschens 616
Die Mechanisierung des Reinigens: Bügeln 619
Die Mechanisierung des Reinigens: Die Geschirrspülmaschine 626
Die Mechanisierung des Reinigens: Der mechanische Abfallzerkleinerer 629
Die Mechanisierung des Reinigens: Der Staubsauger 630
Die frühen Handapparate, um 1860 630
Teppich und Straße 631
Vorstufen des Staubsaugers 633
Der Staubsauger um 1900 634
Die Frage der Herkunft 635
Der Staubsauger wird zum Haushaltswerkzeug 637
Mechanische Kälteerzeugung 644
Natürliches Eis 644
Mechanische Kälteerzeugung seit 1800 647
Mechanische Kälteerzeugung im Haushalt 649
Gefrorene Nahrung 652
Stromlinienform und Vollmechanisierung 655
Der industrielle Designer 658
Herkunft des Stromlinienstils 658
Organisierung des Arbeitsvorganges, um 1935 660
Die Industrie kommt nach 662
Die Küche im dienstbotenlosen Haushalt 667
Das Aufgeben des isolierten Eßzimmers und der isolierten Küche 670
Die Küche als Eßraum? 672
Der mechanische Kern des Hauses 673
TEIL VII
DIE MECHANISIERUNG DES BADES
Die Mechanisierung des Bades 679
Typen der Regeneration 679
Außere Abwaschung oder totale Regeneration? 679
Regeneration in der Antike 681
Die Ausbreitung der verschiedenen Regenerationstypen 685
Regeneration im Islam 688
Das Dampfbad als soziale Institution 695
Das spätgotische Dampfbad 696
Das russische Dampfbad 697
Volkstümliche Regeneration in westlicher Sicht 699
Der Verfall der Regeneration 702
Regeneration im Mittelalter 702
Siebzehntes und achtzehntes Jahrhundert 704
Die Medizin bahnt den Weg 706
Natürliche Erziehung 707
Das Bad des neunzehnten Jahrhunderts 711
Hydrotherapie und Rückkehr zur Natur 712
Das Dampfbad als Einzelzelle, um 1830 714
Versuche einer totalen Regeneration, um 1850 719
Das atmosphärische Bad, um 1870 723
Die Dusche als Volksbad in den achtziger Jahren 728
Die Mechanisierung des Bades 734
Vom Nomadischen zum Stabilen 734
Fließendes Wasser 736
Das englische Badezimmer um 1900 739
Badezimmer und herrschender Geschmack 742
Die amerikanische Badezelle, um 1915 746
Das Chaos um 1900 754
Die Formung des Standardtyps, um 1920 755
Das Bad und der mechanische Kern 758
Regeneration als Kulturrnaß 764
SCHLUSS
Der Mensch im Gleichgewicht 769
Die Illusion des Fortschritts 770
Das Ende mechanistischer Auffassungen 772
Dynamisches Gleichgewicht 774
Nachwort, von Stanislaus von Moos 779
Editorische Notiz 817
Verzeichnis der Abbildungen 821
Register 833



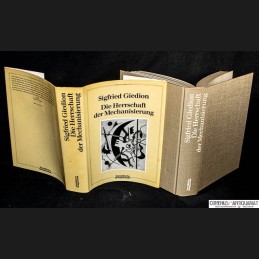
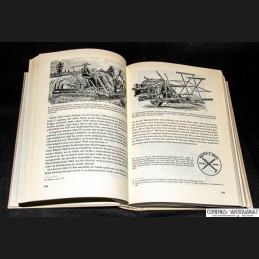

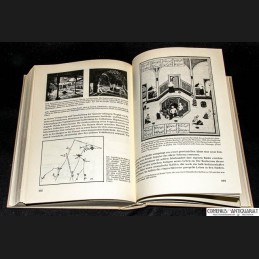
 Datenschutz
Datenschutz
 Versandkosten
Versandkosten
 Google Mail
Google Mail
